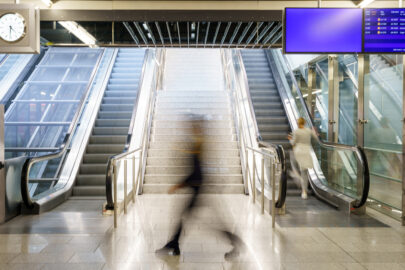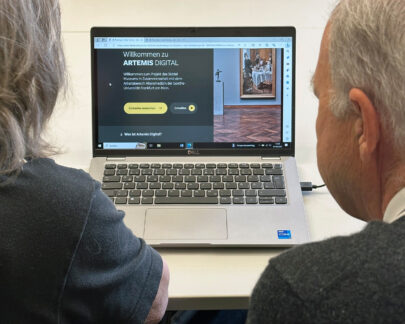Ciao, Ana!
Ana Vuljar war Reinigungskraft, Aufsicht und schließlich das Herz der Städel Zentrale. In 33 Dienstjahren hat sie vier Direktoren erlebt – und wie kaum ein anderer die Entwicklung des Museums.
Das Alarmsystem des Städel funktioniert ausgezeichnet. Ich weiß das, weil ich es vor zwei Jahren selbst ausgelöst habe – ohne böse Absichten natürlich. Beeindruckend, wie schnell zwei Dutzend Polizisten ein ganzes Museum umstellen können. Noch beeindruckender war an jenem Abend allerdings die Frau, die die Aktion koordinierte: Ana Vuljar steht in der Städel Zentrale, vor sich eine Wand voller Überwachungsbildschirme, den Hörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Während sie telefoniert, füllt sie ein Formular auf einem Klemmbrett aus und weist mit Kopfbewegungen die jungen Männer um sich herum an, was sonst noch zu tun ist. So sieht Arbeitsroutine aus. Oder vielleicht auch nur Ana Vuljar, wenn sie zu Höchstform aufläuft. „Du bist die erste dieses Jahr“, ruft sie mir durch die Glasscheibe zu. Wenig stolz, aber etwas beruhigt, verlasse ich wieder den Mitarbeitereingang. „Ciao, Mädel!“, kommt es hinterher.
„Mädel“, oder eben „Junge“, so heißen bei Ana Vuljar mehr oder weniger alle KollegInnen, unabhängig von ihrem Alter oder Status. Niemand beschwert sich darüber. Ana Vuljar ist ein Städel Urgestein: 33 Jahre hat sie hier gearbeitet. Jetzt geht die dienstälteste Mitarbeiterin in den Ruhestand.
Anas Dienstjahre entsprechen am Städel vier Direktoren: Klaus Gallwitz, Herbert Beck, Max Hollein und, seit 2016, Philipp Demandt – „ich bin mit jedem gut zurechtgekommen“. Klaus Gallwitz besucht sie heute noch ab und zu. Dann rauchen beide zusammen auf der Eingangstreppe. „Bei dem musste ich damals gar nicht klopfen, ich bin einfach reingegangen, wenn ich was wollte.“ Das Arbeitsklima war familiär: „Wir waren so klein am Anfang, viel weniger Mitarbeiter. Früher haben wir alles zusammen gemacht. Nach Ausstellungseröffnungen haben wir am nächsten Morgen zusammen im Garten gefrühstückt.“

Feste muss man feiern: Ana Vuljar mit Kollegen beim Museumsuferfest 1989
Die Frühstückszeiten waren irgendwann vorbei, es gab mehr Ausstellungen, Veranstaltungen – und mehr Arbeit. Trotzdem findet sie die Entwicklung gut: „Das Städel ist aus seinem Winterschlaf aufgewacht. Es kommen viel mehr junge Leute, das ist toll.“ Überhaupt ist Arbeit für Ana Vuljar positiv besetzt. Auf die Frage, was ihr am meisten fehlen wird, antwortet sie prompt: „der Montag“.
Ana Vuljar, ausgebildete Friseurin, ist mit 20 aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Ihre beiden Kinder waren fünf und sieben, als sie 1985 im Städel als Reinigungskraft anfing. Sie hat sich um die „Spezialräume“ gekümmert: Büros, die Galerien und Depots. Die Aufgabe empfindet sie heute noch als Privileg: „Besucher dürfen sich die Bilder angucken, ich durfte sie streicheln.“ Die Rahmen; mit dem Staubwedel, versteht sich. Damals hat sie zusätzlich als Aufsicht gearbeitet und auch diesen Job geliebt. Sie mochte es, „immer überall“ zu sein. Deswegen wollte sie zuerst auch partout nicht an die Zentrale, als man ihr die Aufgabe anbot.
Es half nichts: Ihr Talent war erkannt, Ana sollte mehr Verantwortung übernehmen. Für den Job kam nur jemand infrage, der jeden Winkel des Hauses kennt: „Man muss die Leute ja sofort anweisen können, wenn der Alarm angeht.“ Schließlich ist sie auch in der neuen Position voll aufgegangen. Mit der Zeit wurden es mehr Überwachungsbildschirme und vor allem mehr Personal. Unzählige Mitarbeiter und Besucher hat sie in den letzten 14 Jahren durch ihre Panzerglasscheibe gegrüßt: Ciao, Mädel. Ciao, Junge. Die Namen von den vielen neuen KollegInnen kann sie sich ohnehin nicht mehr alle merken. Aber die Gesichter und Telefondurchwahlen kennt sie.

Ciao Mädel. Ciao, Junge: Durch die Glasscheibe der Zentrale hat Ana Vuljar 14 Jahre lang gegrüßt. Jetzt hält ihr Kollege Herbert Waschke die Stellung.
Durch den Mitarbeitereingang ist in den Jahren auch viel Prominenz gegangen. Als sie Kohl und Mitterand reingelassen hat, „da dachte ich, den Kleinen kenn ich doch. Ich hab gesagt: Der sieht aus wie Louis de Funès! Wir haben so gelacht.“ Autogramme wollte sie nur von Schauspieler Paul Hubschmidt („ein sehr schöner Mann“) und „Schweini“. Ihr Lieblingspapst, „der Deutsche“, ist leider nie vorbeigekommen. Ana geht trotzdem so oft wie möglich in die Kirche.

Die junge Ana Vuljar bei einem Mitarbeiterausflug. Der Papst war leider noch nie im Städel.
Wenn man etwas von einer angehenden Rentnerin lernen kann, dann ist es Gelassenheit. Ana Vuljar nimmt die Dinge, wie sie sind – auch die Besucher: „Einmal saß jemand vorm Rembrandt und hat laut geschrien. Der hat sich richtig eingelebt,“ erinnert sie sich aus ihrer Zeit als Aufsicht. Was hat sie gemacht? „Ich hab ihn schreien lassen. Was willst du machen. Leute, die Kunst lieben, sind manchmal anders.“
Ana Vuljar musste in ihrem Beruf Ruhe bewahren, dann wieder sekundenschnell reagieren, koordinieren und sich durchsetzen – wenn es sein musste, auch die Kollegen vom falschen Parkplatz scheuchen. Als ich sie aber frage, was die wichtigste Eigenschaft für ihren Job ist, sagt sie: „Du musst das Haus lieben! Dann geht alles.“ Ihre Stimme senkt sich bedeutungsschwer, als sie mir erklärt: „Das ganze Haus ist wie eine Seele. Du musst mit Gefühl rangehen. Ein Museum ist kein Möbelhaus. Möbel kannst du neu bauen, aber die Kunst… nein.“

Anas Lieblingsbild ist Van Goghs Bauernhaus, es erinnert sie an ihre Heimat. Dieser aufmerksame Mann hat es ihr nachgemalt. Die Kopie hängt nun in Anas Wohnzimmer und gefällt ihr noch viel besser.
Sie gehört zu den Menschen, die nach Feierabend nicht einfach abschalten: „Ich frag mich immer, ob alles gut und sicher ist.“ Fürsorge empfindet sie nicht nur für die Kunst. Sie erzählt mir von der Frau, die vor 25 Jahren vor verschlossener Museumstür stand, eine Studentin aus New York auf der Durchreise nach Mazedonien. Ana unterhielt sie mit ihr auf Kroatisch. Die Frau wollte unbedingt den Vermeer sehen, ihr Promotionsthema. Ana: „Wo ist das Problem? Wir haben sie reingelassen, sie hat sich das Bild allein angeguckt. Wir haben ihr noch einen Kaffee gekocht. Dann ist sie geflogen, wir haben die Geschichte vergessen.“ Zwei Monate Später kommt ein Dankesbrief aus den USA. „Für sie war das ein einmaliges Erlebnis, für uns war das normal.“
„Das ist doch normal“, sagt Ana oft in unserem Gespräch. Auch, als ich sie auf ihren unermüdlichen Kampf gegen den sogenannten Spatzenbaum vor der Zentrale anspreche, der für die darunter stehenden Fahrräder ein Problem ist. Die Vögel vertreibt Ana mit dem Regenschirm. Und wenn es regnet, hat sie schnell einen Haufen Tüten zur Hand, mit denen sie die Sattel abdeckt. „Normal“ ist auch, dass sie die Blumen der Kollegen unter Einsatz von Alufolie rettet. Dass sie ihr Essen teilt und Schwangerschaften anteilsvoll begleitet: „Schwangere Frauen müssen essen.“ In ihrer Fürsorge kann sie radikal sein.

33 Dienstjahre in einem Fotoalbum: Ana erklärt, wer wer ist.
Das Städel war für Ana Vuljar „das halbe Leben, wie eine zweite Familie.“ Als ich sie frage, ob sie in Frankfurt bleibt, schüttelt sie den Kopf: „Nein, nein, das schaff ich nicht, ich muss hier raus. Ich muss was Großes verändern.“ Sie will nach Bayern ziehen, in die Nähe ihrer Tochter und Enkelkinder und sich in einem Hospiz engagieren. Keine Frage, dass sie sich schnell woanders entfalten wird.

Easy Rider Ana Vuljar vor 25 und vor ein paar Jahren
Ana Vuljar hat schon viele Abschiede mitgefeiert, die sind ihr nicht leicht gefallen: „Das Haus ist erst mit den Menschen komplett. Wenn jemand geht, dann fehlt er, wie ein Ziegelstein, den man aus der Wand nimmt.“ Ein Museum besteht eben nicht nur aus Mauern und Kunst – es wird von den Menschen getragen, die darin arbeiten. Mit Ana Vuljar geht ein schwerer Brocken. Ciao, Mädel!

Mittlerweile fährt Ana Vuljar kein Motorrad mehr, zum Abschied gab's dafür ein Fahrrad.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.