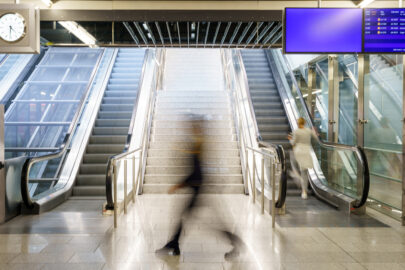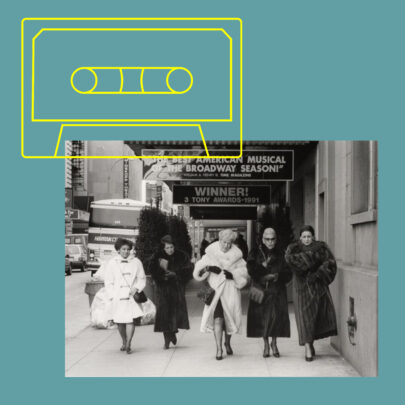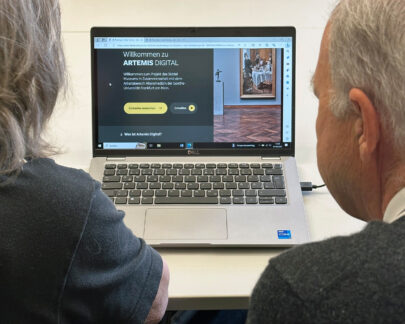Hans-Peter Adamski, Luciano Castelli und Bettina Semmer – „Wildes Denken“
In der Sonderausstellung „Die 80er. Figurative Malerei der BRD“ sind Werke von 27 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen: dynamische, irritierende und neuartige figurative Malerei. Mit drei der Künstler haben wir gesprochen – über künstlerische Haltung, Club- und Musikszenen und den großen Hype.
Auch 30 Jahre nach dem erneuten Aufkommen der figürlichen Malerei in der BRD gibt es Begriffe wie „Heftige Malerei“ oder „Junge Wilde“, die versuchen, dieses Phänomen zu umfassen, aber bis heute hat sich kein Begriff für die Bewegung durchgesetzt. Wie würden Sie selbst diese Malerei betiteln – oder ist es überhaupt möglich und nötig einen Begriff zu finden?
Luciano Castelli: „Heftige Malerei“ war einerseits der Titel einer Ausstellung Ende der 70er-Jahre im „Haus am Waldsee“ in Berlin und beschreibt andererseits die Technik, mit der viele Künstler dieser Epoche gearbeitet haben. Die Themen waren heftig und provokant, und mit heftigem Pinselstrich wurde die Farbe aufgetragen. Als die „Jungen Wilden“ wurde eine kleine Gruppe in der Berliner Szene arbeitender Künstler bezeichnet, deren wildes, ungezügeltes Leben sich außerhalb der Ateliers meist in den berühmt-berüchtigten Clubs sowie als Punk-Rock-Band auf underground- wie auch auf großen Bühnen oder in provozierenden Performances abspielte. Durch den freizügigen und unkonventionellen Umgang mit Sexualität und der Darstellung von Körpern erregten wir Aufsehen. Diese Malerei, welche mit derselben Energie auf die Leinwand gebracht wurde mit welcher wir durch das Nachtleben des Berlins der 80er Jahre peitschten, kann man sicherlich als „heftig“ charakterisieren. Die Ausstellung im Städel zeigt eine große und interessante Auswahl künstlerischen Schaffens der 80er Jahre in Deutschland von (damals) jungen Künstlern dieser Epoche, deren Arbeit jedoch sowohl in Thematik, Stil und Technik weit auseinander liegt und meiner Meinung nach nicht unbedingt unter einem Begriff zusammengeführt werden kann.
Hans-Peter Adamski: Es ist nicht realisierbar diesem Phänomen ein „Label“ zuzuschreiben, da es ungleiche Grundansätze bei der „Mülheimer Freiheit“ in Köln, den Berliner Malern um den Moritzplatz und der Hamburger Gruppierung gab. Meine geistige Heimat war die Konzeptkunst. Es war für mich unvorstellbar, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und zu malen – ein absolutes „No-Go“! Bis ich dann nach einigen Jahren dieser radikalen Positionierung fühlte, dass ich mit dieser Haltung statisch, steif und stur geworden war. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ein alter und konservativer Mensch geworden zu sein. Der Schritt zur Malerei war für mich deswegen eine kalkulierte rationale Entscheidung, ein "Werkzeug", um mich selbst und die Kunstwelt zu irritieren und zu provozieren. Mein Kernsatz in dieser Zeit war: Mit dem Medium Malerei möchte ich mir selbst eine Ohrfeige geben, um wieder wach, frei und offen zu sein. Eine ähnliche Wahrnehmung erkannte ich bei Künstlerkollegen wie Georg Dokoupil und Walter Dahn. Auch Gerhard Kever und Gerhard Naschberger bewegten sich auf dem Feld der Malerei mit viel Selbstironie, einen wieder ganz anderen Ansatz hatte wiederum Peter Bömmels. So konnten wir uns gegenseitig befruchten. Für mich war es gut vorstellbar nach einigen Jahren der Malerei mich von dieser wieder zu entfernen und zur Konzeptkunst zurück zu finden. Wider Erwarten bin ich dann doch dem gemalten Bild bis heute treu geblieben. Bei der Berliner Gruppierung gab es für mich eine grundsätzlich andere Basis. Da ging es aus meiner Sicht primär um die Auseinandersetzung mit der Malerei. Die Hamburger hatten nach meiner Wahrnehmung wieder einen anderen Grundansatz, der nicht ausschließlich auf Malerei bezogen war. Es ist demzufolge schwierig einen treffenden Begriff für diese Bewegung zu finden.
Bettina Semmer: Ich denke, man kann von einem gemeinsamen Aufbruch sprechen, der gegen die Prädominanz von zerebraler Kunst – Minimal, Konzeptkunst, Video - mit deren oft trockenen, inhaltsleeren Ergebnissen aufbegehrte. Malerei als Malerei hatte sich totgelaufen, man wollte sie neu erobern und dem Denken und Fühlen z.B. der queeren Szene in Berlin oder den musikalischen Einflüssen von Post und New Wave und auch vage gesellschaftskritischen bzw. politischen Ideen gefügig machen. Die Malerei sollte uns dienen, nicht umgekehrt. Das war schon bei Immendorff angelegt, Lüpertz und Baselitz hatten ebenfalls Ansätze geliefert, also war es nichts vollkommen Neues. Jeder hatte so seine eigenen Vorbilder, bei mir waren es Polke und Richter, also ein Provokateur und ein Meister der Negation, Stilpluralisten beide. An ihnen konnte man sehen, dass Malerei nicht mehr darum kämpfen musste, eine eigene Handschrift – signature style - zu entwickeln, wie es viele Meisterklassen noch zu verlangen schienen, sondern dass sowohl wildes Denken als auch Reflektion über das Medium selbst darin Platz finden konnten. Wir waren endgültig in der Postmoderne angekommen, mit ihrer nachvollziehbaren Narrativität und ihrem Eklektizismus. Den gemeinsamen Begriff würde ich trotzdem lieber weglassen, schon wegen der Kontinuität mit den genannten Malern.

Bettina Semmer (*1955); Straßenmöbel / Poller, 1985; Öl auf Leinwand, 190 × 155 cm; Bettina Semmer; Foto: Johannes Kramer; © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
Anfang der 80er-Jahre entstand schnell ein großer Hype um die junge deutsche figurative Malerei – Ausstellungen weltweit, Medienrummel und Erfolg auf dem Kunstmarkt. Wie haben Sie diesen Wandel erfahren und erlebt?
Hans-Peter Adamski: Dieser schnelle Welterfolg hat mich, und ich denke uns alle, überrollt. Das war für mich ein Jahr vorher nicht vorstellbar gewesen. Meine Haltung war: „Für die Kunst opfere ich alles!“. Aber natürlich habe ich den explosionsartigen Erfolg genossen. Nach einigen Jahren habe ich jedoch auch negative Seiten dieses Phänomens beobachtet. Immer öfter erlebte ich, dass Kunstkäufer und Sammler nicht mit dem Herzen Bilder von mir erworben hatten, sondern weil wir so angesagt waren. Das hat mich schon sehr irritiert.
Bettina Semmer: Der Hype bringt ja die Gefahr der Überbewertung mit sich – damals hat man natürlich gedacht, dass viele dieser Werke nicht halten würden, was sich die Sammler davon versprachen. Langsam herauszukommen hat auch Vorteile. Ich wurde zwar international ausgestellt, aber nicht mit dem Hype im eigenen Land. Ich konnte beobachten, wie Rosemarie Trockel erst Ende der 80er wirklich große Erfolge feierte, mit Strickbildern, nicht mit Malerei, sondern mit ganz anderen Arbeiten. Während einige der jungen Wilden bereits wieder abgemeldet waren, stiegen diejenigen weiter auf, die etwas Substanzielles zu sagen hatten oder die die Malerei weiter vorantrieben. Nur heftig, nur wild – das reichte nicht.
Luciano Castelli: Es war eine aufregende Zeit. Bis dato konnte ich nicht ausschließlich von den Verkäufen meiner Bilder leben und bestritt meinen Lebensunterhalt mit Jobs hinter dem Tresen einschlägiger Nachtlokale. Plötzlich wurden unsere Bilder in den großen Museen gezeigt und namhafte Galerien interessierten sich für unsere Werke. Wir fühlten uns wie Rockstars, wenn wir von der Konzertbühne zum Flughafen fuhren, um zu unseren Ausstellungen nach New York, London oder Paris zu fliegen.

Hans Peter Adamski (*1947); Das Land des Lächelns (Wolfgang),1981; Dispersion und Aquarell auf Leinwand, 178 × 266 cm; Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Dauerleihgabe Sammlung Tiefe Blicke; Foto: Wolfgang Fuhrmannek; © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
Die internationale Club- und Musikszene, New Wave und Punk, aber auch Künstlerkneipen sind Themen, die sich in einigen der Arbeiten wiederfinden. Rückblickend betrachtet, haben die Sphären Musik und Kunst sich bei Ihrer Arbeit gegenseitig beeinflusst, und falls ja, inwiefern?
Luciano Castelli: Kunst spiegelt meist einen gewissen Zeitgeist, das Umfeld, kulturelle Veränderungen, individuelle Gefühle oder die Haltung zu einem politischen Thema. In unserem Fall entstanden die Arbeiten aus dem unmittelbar persönlich Gelebten und der damaligen Berliner Subkultur. Mit der Emotion des Augenblicks wurden meine Erfahrungen auf die Leinwand oder in ein anderes Medium übersetzt. Ich begann bereits Ende der 60er-Jahre, damals noch in der Schweiz, mich in diversen Rollen zu transformieren und das darin Gelebte und Empfundene in Fotografie, Malerei, Performance oder in Objekten darzustellen. 1978 traf ich in Berlin mit Salomé und Rainer Fetting zusammen, wir verbrachten viel Zeit miteinander, machten gemeinsam Musik, schminkten uns gegenseitig für Performances, schufen Gemeinschaftsbilder. Mit Salomé gründete ich die Punk-Rock-Band „Geile Tiere“, wir gaben Konzerte, unter anderem als Vorgruppe von Nina Hagen. Mit Rainer Fetting realisierte ich den Indianerfilm „Room full of mirrors“. Natürlich beeinflusste unser exzessive Leben unser Schaffen, das Erlebte spiegelte sich in der Fotografie wieder, diese beeinflusste die Bilder, es entstanden Filme oder Skulpturen daraus, ein Medium inspirierte das andere.
Bettina Semmer: Wir haben ebenfalls Musik gemacht, es gab ein gemeinsames Konzert und eine Platte, die Doppel-LP „Kirche der Ununterschiedlichkeit“. Auch hier galt die Haltung „wir haben es zwar nicht gelernt, aber wir wissen, was wir sagen wollen, also können wir auch entscheiden, wie es geht“. Für mich war eine lange Phase des Experimentierens mit analogem Film wichtig, wo Methodik und Kontinuität einer Tradition (des strukturellen Films, vorwiegend aus den USA) eine Rolle spielten. Hier konnte ich Neuland betreten und gleichzeitig in einem Feld interessanter Künstler existieren, in Hamburg zum Beispiel Emigholz und Wyborny. Dagegen wirkte Malerei lange verstaubt. Dass ich trotzdem wieder anfing zu malen, hing tatsächlich mit der Art Rebellion zusammen, auch einer kollektiven, ich malte mit Albert Oehlen gemeinsam große Bilder auf Packpapier, in denen wir Themen und Techniken auf die Probe stellten, die später auf Leinwänden Halt fanden. Er war direkt vom Punk und später Free Jazz begeistert, und das drückte sich in der Haltung des Dilettantismus aus (nimm zwei Akkorde...), der natürlich auf Dauer keiner war.
Hans-Peter Adamski: Diese Club- und Musikszene hat mich sehr begeistert. Aber bezogen auf meine Malerei hat sie mich offensichtlich nicht inspiriert.

Luciano Castelli (*1951); Berlin Nite, 1979; Kunstharz auf Nessel, 240 × 200 cm; Luciano Castelli; Foto: Luciano Castelli; © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
Anfang der 1980er Jahre lebten und arbeiteten Sie jeweils in einem der drei künstlerischen Zentren Westberlin, Hamburg und dem Rheinland. Hatten Sie auch Austausch zu Künstlern aus den anderen Gebieten? Wie haben Sie die Gleichzeitigkeit dieses Phänomens in den drei Zentren wahrgenommen?
Bettina Semmer: Ich hatte in Hamburg studiert, hielt mich aber oft auch im Rheinland auf. Einerseits in meiner Heimatstadt Düsseldorf, wo Immendorff „Finger für Deutschland“ in seinem Atelier organisierte und ich Kontakt zu Beuys- und Becherschülern hatte. Andererseits in Köln, wo wir Kippenberger und den Galeristen Hetzler besuchten. Von 1984 bis 85 lebte ich in Köln und arbeitete dort in unmittelbarer Nähe zur Galerie Monika Sprüth, oft zusammen mit Rosemarie Trockel und Jutta Koether, andere Kolleginnen wie Johanna Kandl aus Wien und Michaela Melián aus München kamen hinzu. Wir organisierten uns überregional, um den männlichen Seilschaften etwas entgegenzusetzen. Auch zu Schulze, Dahn und Dokoupil hatte ich Kontakt, ich teilte mir anfangs eine Wohnung mit George Condo, der meist nachts an winzigen Bildern malte. Auch nach Berlin gab es Kontakt zu Barfuß/Wachweger, die sich – über Kippenberger – wohl mehr mit den Hamburgern verbunden fühlten, als mit den Künstlern am Moritzplatz. Kurz, ich nahm die Gleichzeitigkeit wahr als befruchtende Konkurrenz, wo sich verschiedene Standpunkte durch Abgrenzung und Anfeuern herauskristallisierten.
Hans-Peter Adamski: Mit meiner damaligen Neugierde und Offenheit empfand ich es als sehr spannend, verschiedene Grundansätze in dieser aktuellen Malerei zu erleben. Trotz allem gab es schon gewisse Überschneidungspunkte. Ich erlebte es als Bereicherung, dass nicht alle Grundhaltungen identisch waren.
Luciano Castelli: Wir waren hingegen nur auf unseren eigenen Kosmos konzentriert –Berlin war zu jener Zeit mit einer „Insel“ zu vergleichen, die unseren Kosmos darstellte aus dem wir unsere Inspiration schöpften und in dem wir agierten. Einen persönlichen Kontakt zu Künstlern aus den anderen Kunstzentren hatte ich selten. Martin Kippenberger bildete eine Ausnahme, da er in Berlin lebte. Ihre Werke jedoch waren bekannt durch Veröffentlichungen.

"Aktualität und Wirkung der eigenen Werke": Blick in die Ausstellung im Städel. Foto: Städel Museum
Welches Werk hat Sie beim Rundgang durch die Ausstellung „Die 80er“ im Städel am meisten irritiert, verblüfft, berührt?
Bettina Semmer: Ich war überrascht von dem Mut und der Frische der Bilder von Salomé, vor allem beeindruckt die Monumentalität von „Kadewe“. Christa Nähers Bilder „ohne Pferde“ – sie wurde damals als Pferdemalerin etikettiert – fand ich gut, sie erinnern mich an den frühen, heftigen Cézanne. Ich bin auch berührt von der Aktualität und Wirkung meiner eigenen Bilder im Kontext der Ausstellung. Insgesamt ist es eine sehr überzeugende Präsentation.
Hans-Peter Adamski: Der erste Rundgang durch die Ausstellung war sehr berührend für mich. Nicht nur auf meine Bilder bezogen, die ich seit dreiundzwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte, sondern auch auf die Werke anderer damaliger Kampfgenossen.
Luciano Castelli: Mit dieser Ausstellung im Städel bekam ich die Gelegenheit viele Bilder meiner Kollegen dieser Zeit erstmals im Original zu sehen. Ich bin beeindruckt von der Präsenz und Frische vieler Werke. Einige der Exponate haben mich in meine Vergangenheit entführt und kommen mir nach wie vor emotional sehr nahe.
Ich danke Ihnen für das Gespräch!
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.