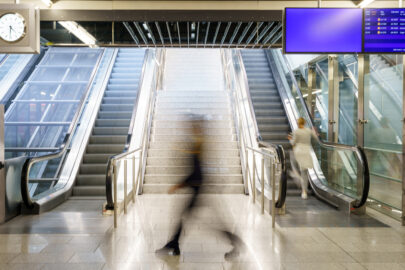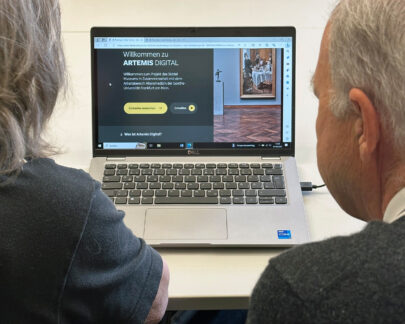Die Kunst in unserem Kopf
Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir Kunst betrachten? Was gefällt wem, warum und unter welchen Bedingungen? Die empirische Ästhetik sucht Antworten.
Neulich im Städel Museum: Eine Besuchergruppe steht vor Vermeers Geografen. Es handele sich um ein Werk des niederländischen Goldenen Zeitalters, sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft, erzählt die Kunstvermittlerin. Eine Museumssituation, soweit, so normal. Fast jedenfalls. Eigentlich interessieren wir uns nämlich gerade gar nicht so sehr für das berühmte Meisterwerk an der Wand, sondern für eine der BesucherInnen, die aufwendig verdrahtet mitten in der Gruppe steht. Das EEG misst ihre Gehirnaktivitäten während der Führung durch die Altmeister-Sammlung. Die anderen Teilnehmer schauen sie immer wieder an: Was passiert wohl in ihrem Kopf? Gefällt ihr das Gemälde?

Führung bei den Alten Meistern im Städel. Dabei geht es an diesem Abend nicht nur um die Kunst, sondern vor allem um die Betrachterin in der Mitte. Foto: F. Bernoully, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, 2018
Das kleine Schauexperiment ist Teil einer Tagung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik im Städel Museum. Hier trifft Neurowissenschaft auf Kunst. Das Zusammentreffen ist tatsächlich ein Meilenstein für die Neuroästhetiker, fanden ihre Untersuchungen in den vergangenen Jahren doch vor allem unter den künstlichen Bedingungen eines Labors statt. Der Abend trägt daher auch den filmreifen Titel Neuroaesthetics in the Wild. Ein Kunstmuseum wird zur unberechenbaren Wildnis – jedenfalls im Vergleich zum „sterilen“ Labor.
Empirische Ästhetik
Edward Vessel ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Er freut sich offensichtlich über den Schritt seiner jungen Disziplin ins Museum. Als eine Abzweigung der Neuroästhetik versucht die empirische Ästhetik die psychologischen Prozesse und die Mechanismen im Gehirn während der ästhetischen Rezeption zu erforschen: Was macht das Betrachten eines Gemäldes oder einer Tanzperformance zu einer „schönen“ Erfahrung? Wie individuell ist ästhetischer Geschmack? Edward Vessel und seine KollegInnen gehen Fragen wie diesen auf den Grund. Dabei geht es allerdings nicht darum zu analysieren, was die Schönheit oder die Erhabenheit eines Gemäldes ausmacht, sondern wie und aus welchen Gründen wir etwas empfinden.

Auf dem Podium von „Neuroaesthetics in the Wild“ im Städel diskutierte Edward Sessel (ganz links) mit (v. l. n. r.) der Tänzerin und Choreografin Kristina Veit, Helmut Leder (Professor für Kognitive Psychologie an der Universität Wien), Suzanne Dicker (Wissenschaftlerin an der Utrecht University und New York University), Regina Oehler (Wissenschaftsjournalistin beim Hessischen Rundfunk) und Chantal Eschenfelder (Leiterin der Bildung und Vermittlung am Städel Museum). Foto: F. Bernoully, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, 2018
Die Forschung geht weit zurück. Schon Philosophen der Antike beschäftigten sich mit Fragen der ästhetischen Erfahrung. Aber der Begründer der empirischen Ästhetik, der Psychologe Gustav Fechner (1801–1887), konnte noch nicht zum Durchbruch der Wissenschaft beitragen. Erst vor rund 15 Jahren emanzipierte sich der Fachbereich der Neuroästhetik innerhalb der Hirnforschung. Mittlerweile interessieren sich auch Künstler, Designer – oder eben Museen – für die Ergebnisse. „Wenn wir besser verstehen, wie Menschen mit Kunst in Verbindung treten, könnten wir auch den Museumsbesuch noch gezielter gestalten, zum Beispiel mit einer spezifischen Präsentation der Sammlung oder entsprechenden Führungen,“ sagt Chantal Eschenfelder, Leiterin der Bildung und Vermittlung am Städel Museum.
Kunstrezeption mal anders
Und wo steht die Forschung momentan? Edward Vessel gewährt einen Einblick in seine derzeitigen Projekte: Gerade untersucht er, wie sich bestimmte, intern und extern orientierte Hirnnetzwerke bei einer ästhetischen Rezeption verhalten. Das interne Netzwerk wird vor allem beim Nachdenken oder bei Tagträumen aktiviert, das externe, wenn wir visuelle Reize wahrnehmen. Vessel findet immer mehr Belege dafür, dass diese beiden untersuchten Netzwerke gleichzeitig aktiv sind, wenn wir durch ein Werk innerlich bewegt werden. „Dieser Gehirnzustand ist einzigartig“, so Vessel.
Bislang war die Studiendurchführung an eine Laborumgebung gebunden, zu groß waren die Unwägbarkeiten „in der Wildnis“, die technischen Mittel noch nicht ausgereift genug. Im Labor bekommen TeilnehmerInnen verschiedene Kunstwerke unterschiedlicher Stile, Epochen, Kulturen und Gattungen gezeigt und sollen diese anschließend bewerten. Währenddessen registriert ein Gerät ihre Hirnaktivität . Die Antworten und die Messdaten werden anschließend in einen statistischen Zusammenhang gebracht. So lässt sich bestimmen, wie sich eine ästhetische Erfahrung auswirkt.

Mit speziellen Messungen wird die neurophysiologische Aktivität während einer Kunstrezeption erfasst, darunter die Atmung oder Herzfrequenz. Foto: F. Bernoully, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, 2018
Ab ins Feld!
Laborstudien – so wichtig sie für viele Untersuchungen auch sind – haben allerdings auch ihre Makel: Der Betrachter ist in seiner Autonomie eingeschränkt. Er kann nicht, wie im Museum, entscheiden, welches Gemälde er sich ansehen möchte und wie lange. Er ist allein und kann sich nicht austauschen. Das alles verzerrt die Ergebnisse. Verständlich also, dass das nächste große Ziel die Feldforschung ist. Der Tagungsabend im Städel macht den Aufschlag.
Neben der Besucherin mit dem EEG wurden noch zwei andere TeilnehmerInnen beobachtet. Ein zweiter Teilnehmer trug ein physiologisches Messinstrument, das Atmung, Hautreaktion oder Gesichtsmuskelbewegungen erfasst, die dritte Person durfte eine Eye-Tracker-Brille aufsetzen, mit der sich Blickrichtungen verfolgen lassen. Noch seien diese mobilen Geräte allerdings nicht präzise genug, erklärt Edward Vessel, um mit den komplexen Messmethoden im Labor mitzuhalten – sie ermöglichen aber einen ersten Schritt in den Dschungel.

Auch ein Eye-Tracker kommt bei den Untersuchungen zum Einsatz. Foto: F. Bernoully, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, 2018
Es gibt noch viel zu tun
Aber kann man so ein komplexes und persönliches Erlebnis wie das Betrachten eines Kunstwerks überhaupt statistisch erfassen? Vessel möchte gar nicht abstreiten, dass die Erfahrung mit und die Bewertung von Kunst sehr subjektiv ist: „Auch wenn wir öfters überraschende Gemeinsamkeiten in den Hirnreaktionen der Probanden während einer starken, ästhetischen Erfahrung finden, können zwei Menschen dasselbe Bild anschauen und komplett verschieden emotional darauf reagieren“, sagt er. „Manche Menschen fühlen sich von klassisch schönen Gemälden angezogen, während andere Gemälde bevorzugen, die sie emotional herausfordern, weil sie negative Thematiken ansprechen.“
Bisher ist bekannt, dass die Geschmäcker bei naturalistischen Motiven sehr ähnlich sind, bei abstrakten Werken klaffen die Meinungen dagegen stärker auseinander. Diese Geschmäcker bilden sich erst im Erwachsenenalter heraus. Es deutet sich auch an, dass unsere Persönlichkeit einen Teil dazu beiträgt, wie intensiv wir auf Kunst reagieren. Jemand, der tendenziell eher offen für neue Erfahrungen ist, wird auch „ungefälliger“ Kunst gegenüber aufgeschlossen sein. Es gebe noch Vieles, das noch nicht über individuelle Unterschiede zwischen Menschen bekannt sei, sagt Edward Vessel. „Wir fangen erst an, uns an die riesige Bandbreite heranzutasten.“ Aber: „Es existiert auch nicht das eine Motiv, das jedem gefällt.“
Abgesehen von unserem Geschmack: Hat denn Kunst Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Der Neuroforscher vermutet, dass sich eine Beschäftigung mit Kunst positiv auf das eigene Wohlbefinden auswirkt. Schließlich beruft sich auch die Kunsttherapie schon lange auf die positive Auswirkung von Kunst auf die mentale Gesundheit.
Auch wenn die empirische Ästhetik erst am Anfang ihrer Möglichkeiten steht, ist Edward Vessel überzeugt: „Kunst zu erleben, hinterlässt einen bleibenden Eindruck und verbessert unsere Lebensqualität.“ Das weiß man im Städel ja schon lange.

Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.