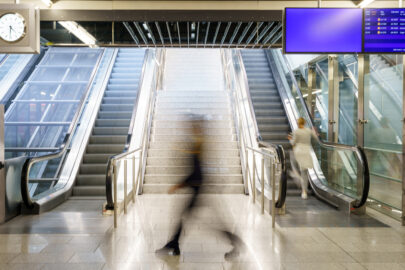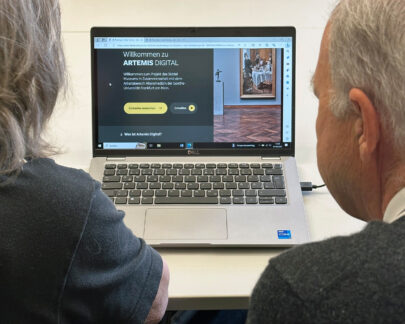Die Kunst der Koordination
Hinter van Gogh steht eine Frau – und sie hält meistens ein Handy in der Hand: Katja Hilbig hat am Städel schon viele Ausstellungen umgesetzt, MAKING VAN GOGH war für sie aber eine besondere Herausforderung.
Ich treffe Katja Hilbig in den Gartenhallen des Städel, dort, wo in einer Woche die Ausstellung MAKING VAN GOGH eröffnen soll. In dem weitläufigen Galerieraum wurden in den letzten zwei Monaten Wände neu eingezogen und gestrichen, insgesamt 1.290 Liter Farbe verbraucht. Eine ganz neue Architektur ist entstanden, mit einem geführten Rundgang, einer großen Piazza und Sitzbänken in der Mitte, einem Shop, Ateliertischen und einem Audioguide-Tresen. Für diese Ausstellung wurde alles neu gedacht – und es musste groß gedacht werden: Wo Van Gogh ist, ist mit vielen Besucherinnen und Besuchern zu rechnen. MAKING VAN GOGH ist die aufwendigste Ausstellung, die das Städel bis jetzt umgesetzt hat. Und Katja Hilbig ist die koordinatorische Schaltzentrale.
Nächste Woche soll es losgehen. Man könnte Hektik erwarten. Stattdessen ist es um uns herum erstaunlich ruhig. Die wenigen Menschen, die hier arbeiten, scheinen entspannt und gleichzeitig nur auf die Kunst konzentriert. 120 Gemälde und Zeichnungen werden an den Wänden angebracht, davon allein 50 van Goghs. „Aufbau braucht Ruhe und Geschlossenheit,“ sagt Katja. In gewisser Weise erntet sie jetzt, was sie in den letzten fünf Jahren gesät hat – so lange hat man sich im Städel auf die kommenden vier Monate vorbereitet. Heute wurde das erste Van-Gogh-Werk gehängt, „da standen wir alle davor und dachten Wow. In so einem Moment ist man schon stolz, dass diese Kunst überhaupt hier sein kann. Die Museen und Sammler bringen uns mit ihren Leihgaben ein sehr großes Vertrauen entgegen.“
Dieses Vertrauen hat sich das Städel über viele Jahre erarbeitet. Seit 2001 leitet Katja hier am Haus den sogenannten Ausstellungsdienst. Was sie genau macht? Nun, wie bei allen Menschen, die Fäden zusammenhalten, ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Katja ist vom Anfang bis zum Ende einer Ausstellung mit dabei. „In dem Moment, in dem die Besucher ins Haus kommen, hört meine Arbeit auf.“ Diese Arbeit führt sie auf verschiedenen Ebenen aus, auf einer administrativen, einer gestalterischen, einer kommunikativen und einer sehr praktischen Ebene – mitunter steigt sie sogar selbst auf die Leiter.
Heute kann man Katjas Beruf unter der Bezeichnung „Kulturmanagement“ studieren. Die Erfahrung aber, die kann man nur machen. Ein wichtiger Part: Verträge aufsetzten und mit Museen, oft Juristen verhandeln, Versicherungen abschließen, Vereinbartes umsetzen – über hundert Mal wurde dieses Prozedere bei dieser Ausstellung durchgespielt. Sorgfalt ist nur ein Must-have ihrer Jobbeschreibung: „Die Aktenlage ist das A und O“. Allein für Van Gogh haben Katja und ihr Team 17 Leitz-Ordner gefüllt, Tendenz steigend.
Die Leihverhandlungen ziehen sich als Subtext durch den ganzen Prozess, „manche Verträge bekommen wir erst eine Woche vor Ausstellungsbeginn“. Bei so hochwertigen Leihgaben wie bei van Gogh ist in der Regel aber alles frühzeitig festgezurrt. „Wenn man solche Sahnestücke haben möchte, hat man es auf allen Ebenen mit sehr professionellen Kollegen zu tun. Man begegnet sich auf Augenhöhe und ist sich über die Spielregeln im Klaren“. Schließlich ist das Städel nicht nur Leihnehmer, sondern auch -geber. Überhaupt hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert, professionalisiert und routiniert, erzählt Katja – aber auch verschärft. Nach 9/11 seien die Sicherheitsvorgaben zum Beispiel viel strenger geworden. „Die Gefühlslage hat sich bei allen Leihgebern verändert.“

Da drängt sich eine Frage natürlich auf: Wie fühlt es sich an, mit so wertvollen Gemälden zu hantieren? Katja beteuert, dass sie auch jetzt, wo die Werke reisen und hier ankommen, einen soliden Schlaf hat. „Die Sicherheit der Kunst steht natürlich an oberster Stelle. Und mit den Werten muss man umgehen lernen. Man darf bei den Nullen nicht schlampen.“ Gelobt sei der 1000er-Punkt bei Exel. Die Nullen hinter van Gogh haben auf Katjas Arbeit jedenfalls keine Auswirkungen: „Für uns darf es keinen Unterschied machen, ob wir eine kleine oder große Ausstellung realisieren. Unsere Arbeit definiert sich nicht über Versicherungswerte. Jede Ausstellung wird mit derselben Sorgfalt umgesetzt.“
Was dieses Projekt für Katja und ihr 8-köpfiges Team allerdings zu einer wirklichen Herausforderung macht, sind die Veränderungen im Haus: Erstmals findet eine Sonderausstellung in den Gartenhallen statt. Der Neubau mit seinem markanten Grashügel wurde 2012 eröffnet und beherbergt seitdem die Sammlung Gegenwartskunst. Die Entscheidung, die Ausstellung hierhin zu verlegen, wurde erst nach einer Machbarkeitsstudie getroffen. „Alles müssen wir jetzt an einen anderen Ort transferieren – auch viele Dinge, über die ich seit Jahren nicht mehr nachdenken musste, weil sie ihren festen Platz hatten, Fluchtwege oder einen Erste-Hilfe-Raum.“
Wie sehr sich die Arbeit in den Gartenhallen von der im Peichl-Bau, dem regulären Ort für Sonderausstellungen, unterscheidet, macht Katja an einem scheinbar kleinen Unterschied deutlich: „Die Wände im Peichl-Bau sind 4 Meter hoch, in den Gartenhallen 5,50 Meter. Wandplatten, die man normalerweise zu zweit aufstellen und bearbeiten kann, können hier nur mit technischen Hilfsmitteln bewegt werden. Das ist ein komplett anderes Arbeiten. Bisher eingespielte Abläufe müssen neu antizipiert werden. Oft kann man aber erst im Prozess darauf reagieren.“ Auch deswegen hat der Aufbau früh begonnen. Hier zeigt sich aber die Kunst der Planung: genug, aber nicht zu viel Zeit einzukalkulieren.
Die Qualität der Gartenhallen definiert sich – neben der Größe – durch das Tageslicht, das durch die prägnanten Oberlichter eindringt. „Bei Van Gogh müssen wir die Helligkeit aber kontrollieren und unseren Leihgebern auf das Lux genau geregelte Lichtverhältnisse garantieren.“ Die runden Dachluken lassen sich in unterschiedlichen Stufen abdunkeln und wurden von innen zusätzlich abgehangen – dadurch sieht der Grashügel während MAKING VAN GOGH bei Dunkelheit übrigens auch von außen anders aus.
Geändert wurde außerdem das dialogische System der Präsentation: Wo normalerweise ein offenes Durchschlendern gewünscht ist, verlangt eine Ausstellung dieser Größenordnung, die zudem einer Erzählung folgt, eine gelenkte Wegeführung. „Die Besucher sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren können.“ Es sind viele Schrauben, die diese Ausstellung zusammenhalten und die, wenn gut verarbeitet, am Ende weder sicht- noch spürbar sein sollen. Da geht es um das richtige Klima, ein Alarmsystem und das passende Licht, um Schalldämpfung und die Lesbarkeit von Texten. Es geht um genug Raum, den jeder vor der Kunst haben soll; und um Orte, an denen man sich treffen und austauschen kann.
Katja hat sich mit den Kuratoren und dem Architekturbüro BachDolder über solche Fragen viele Gedanken gemacht. Früher oder später hat sie aber mit allen Abteilungen des Städel zu tun, mit der Bildung & Vermittlung, dem Veranstaltungsmanagement, der Verwaltung und der Haustechnik, mit der Presse und dem Marketing, mit der Restaurierung, dem Shop, der IT, mit dem Sicherheitsdienst und dem Besuchermanagement. Gerade eine Ausstellung wie van Gogh muss ein breites Spektrum an Bedürfnissen abdecken. Umgekehrt hängt der Erfolg eines solchen Projektes auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ab: „Eine Ausstellung ist keine Soloveranstaltung, und das macht auch die Stärke unseres Hauses aus.“
Bei all diesen internen Berührungspunkten, aber auch externen, mit Juristen, Kuratoren und Kurieren, mit Speditionen, Architekten, Malerbetrieben, Handwerkern, Beleuchtern und Technikern, mit Grafikern und dem Hängeteam: Wie behält man da den Überblick? „Alles auf der Festplatte,“ sagt Katja und meint damit nicht ihren Computer, der seit zwei Monaten in den Gartenhallen aufgebaut ist. Sie tippt sich auf die Stirn. „Ich mache mir Notizen, die merke ich mir fotografisch. Was nicht haftenbleibt, ist nicht wichtig.“ Abhängig ist sie aber von ihrem Smartphone: „Zu meinem Abschied in der Schirn Kunsthalle habe ich ein aufblasbares Handy, ein Schokohandy und einen Handykuchen bekommen. Das war 2001, damals war ich schon die mit dem Telefon. Oft ist es eben besser, den Hörer in die Hand zu nehmen, statt noch eine Mail zu schreiben.“ In ihrem Van-Gogh-Postfach befinden sich aktuell trotzdem 3.735 Mails.
Die vielen Menschen, mit denen Katja zu tun hat, sieht sie nicht als Problem, sondern als Schlüssel zum Erfolg: „Das wichtigste ist das Netzwerk: Zu wissen, wen man bei einem Problem kontaktieren kann. Alle anderen Abläufe sind Standard, auch wenn sie natürlich auf einem hohen Niveau funktionieren müssen. Die Kunst fängt aber da an, wo es um Improvisation geht. Was machst du zum Beispiel, wenn kurz vor einer Eröffnung ein Vulkan ausbricht?“ Genau, der mit dem unaussprechlichen Namen. Ein Kollege saß damals mit einem Kirchner-Gemälde drei Tage am Flughafen in Chicago fest. „Dann ist es deine Verantwortung, ihn hierher zu bringen. Etwas auf dem Reißbrett zu planen und eins-zu-eins umzusetzten, das bietet die Realität nicht.“
Dieser Job scheint zu funktionieren wie eine gut laufende Batterie mit Plus- und Minuspol: Struktur und Planung auf der einen – Spontaneität und Improvisation auf der anderen Seite.
Katjas Telefon klingelt gerade wieder, nicht zum ersten Mal in diesem Gespräch. Ein Hubwagen gleitet geräuschvoll an uns vorbei. Wirklich ruhig ist es eben doch nicht. Katja muss rangehen, weitermachen mit MAKING VAN GOGH.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.