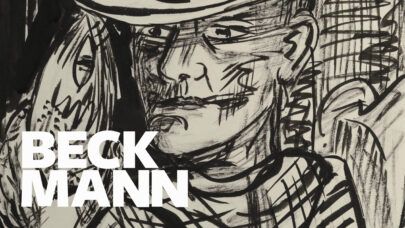Kühlschrankerotik oder zeitloses Ideal?
Bevor unsere Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ am Sonntag, 26. Mai 2013 ihre Pforten schließt, wollen wir den Titel der Schau auf unserem Blog noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. In diesem ersten Teil widmen wir uns deswegen dem Thema Schönheit, im nächsten Blogbeitrag der Revolution.

Bertel Thorvaldsen (1770–1844); Hebe, 1815–1823; Marmor, 156,5 cm; Thorvaldsens Museum; Foto: Thorvaldsens Museum; Eigenhändiges Marmorexemplar nach dem originalen Gipsmodell aus dem Jahre 1806-1807
Während das Model Heidi Klum im Privatfernsehen ständig von Neuem nach der Schönsten unter den Schönen sucht, wurde die Frage nach der Schönheit im Klassizismus anders beantwortet: Wer damals das Prädikat „Schönheit“ erhielt, war nicht nur äußerlich attraktiv, sondern glänzte auch durch innere Qualitäten. Die Losung hieß „edle Einfalt und stille Größe“. Auf so manchen wirkt das klassizistische Schönheitsideal dadurch heute kühl und belehrend. Aber wird dieses Urteil der damaligen Suche nach Schönheit auch gerecht?
Exkurs: Schönheit im Wandel
Gibt es einen „Common sense“ bei der Definition von Schönheit? Unser Empfinden darüber ist eng verquickt mit der Mode. Abseits vom Zeitgeschmack aber ist die Jugend – zumeist die weibliche – ein gleichbleibender Parameter für Schönheit und wird daher oftmals synonym verwendet. Das Muster hat sich im Laufe der Jahrhunderte kontinuierlich gewandelt. Entwürfe man ein chronologisches Diagramm der Ideale vom weiblichen Körperumfang, gliche dies vermutlich einem Relief der Schweizer Alpen. Die Antike bevorzugte gleichmäßig proportionierte Mädchentypen und kraftvolle Athleten, im Mittelalter galten schlanke Frauen mit kleinen Brüsten und anschwellendem Bauch als attraktiv. Die Renaissance schätzte den üppigen Leib und gar das Doppelkinn, weidete ihr Auge aber auch an der zierlichen „Bellezza Ideale“ eines Sandro Botticelli. Wohlgenährte und fleischige Damen bestimmten das Bild der Barockzeit, wovon die Figuren Rubens’ die wohl bekanntesten sind.
Klassizismus: Über Geschmack lässt sich streiten
Für die Vertreter des Klassizismus verkörperte die barocke Ästhetik zu viel Schein und zu wenig Sein. Alles Verspielte und Übersteigerte des Stils wurde jetzt zugunsten einer klaren Formensprache getilgt. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt ein Scholastiker-Sprichwort. Aber, so nimmt es eine Vorstellung des Klassizismus an: es gibt einen guten Geschmack – und demzufolge auch einen schlechten. Der Gegenstand ist also durchaus diskussionswürdig. Guten Geschmack könne man erlernen, man müsse gewissermaßen „auf den Geschmack kommen“, um einen höheren Sinn für Schönheit zu entwickeln.

Antonio Vanni (1781–1851?); Apoll vom Belvedere, nach 1866 und vor 1903 (?); Gipsabguss, 235 × 150 × 100 cm; Marburg, Philipps-Universität, Archäologisches Seminar; Foto: Norbert Miguletz
Unnachahmlich durch Nachahmung
Der Schlüssel zum „guten Geschmack“ lag für die Künstler des Klassizismus im Studium der Werke der klassischen, insbesondere der griechischen Antike: „Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten“, wie es der klassizistische „Cheftheoretiker“, der Archivar Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) folgenreich formulierte. Der dekadenten Gegenwart stellte er die Antike als verlorenes goldenes Zeitalter gegenüber. In der Kunst der „Alten“ sahen die klassizistischen Künstler einen überzeitlichen Wert artikuliert, der als vorbildlich und nachahmenswert galt. Barock und andere Stile schienen dagegen bloß flüchtige Modeerscheinungen zu sein. Die antike Skulptur des „Apoll vom Belvedere“, die als Gipsabguss in der Ausstellung zu sehen ist, hielt Winckelmann für das „höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Alterthums“. Sie gehörte zum Kanon der berühmtesten Antiken, wurde im Klassizismus vielfach kopiert und diente den Künstlern als Studienobjekt auf ihrer Suche nach der idealen Form. Nachahmen bedeutete aber nicht nachmachen. Vielmehr sollte mithilfe des Studiums der Linien und Proportionen antiker Werke eine neue, eigenständige Vielfalt gefunden werden.
Schönheit braucht Köpfchen
Wie sah sie nun aus, die unnachahmlich Schöne? Fettpölsterchen oder ungebändigtes Haar, wie sie beispielsweise bei Rubens’ berühmten „Drei Grazien“ zu sehen sind, hatten an einer klassizistischen Schönheit nichts zu suchen. Deutlich zeigt sich das beispielweise bei Bertel Thorvaldsens anmutiger Skulptur der „Hebe“ (1815–1823), die gleich im ersten Saal der Ausstellung zu sehen ist: Die Bewegung ist deutlich zurückgenommen, das Haar zusammengesteckt, Gestik und Mimik sind aufs Wesentliche reduziert – weniger ist hier mehr. Damit zeigt sich der Klassizismus als Kind der Aufklärung: Wahre Schönheit wird nicht allein sinnlich, sondern auch über den Verstand erfasst. Das Auge verlustiert sich nicht am netten, alltäglichen Pläsir. Es lässt sich von reinen Äußerlichkeiten nicht blenden, sondern prüft das moralische Gebäude dahinter, das sich im Maßvollen ausdrückt.

Jacques-Louis David (1748–1825); Patroklus, 1780; Öl auf Leinwand, 122 x 170 cm; Cherbourg-Octeville, Musée d'art Thomas-Henry; © Daniel Sohier
Bedingungsgefüge von äußerer und innerer Schönheit
Für Winckelmann zeigte sich echte Schönheit nur im Zustand der Ruhe. „Edle Einfalt“ und „stille Größe“ hieß seine vielzitierte Forderung. Ausgreifende Bewegungen oder dramatische Mimik erschienen als Ausdruck von Hemmungslosigkeit, als deplatziert. Es galt, die menschlichen Leidenschaften zu beherrschen. Im Unterschied zu Darstellungen im Barock sollte das Äußere auch das Innere widerspiegeln. Dies betraf nicht nur die Fassadengestaltung in der Architektur, sondern auch die Darstellung des Menschen. Als schön galt aber natürlich nicht nur das sogenannte schöne Geschlecht. In der Künstlerausbildung spielte gerade auch der männliche Akt eine zentrale Rolle. Ein großartiges Beispiel ist die Aktstudie des „Patroklos“ (1780) des französischen Malers Jacques-Louis David (1748–1825), dessen Haltung der antiken Figur des „Sterbenden Galliers“ entlehnt ist. Der athletische Rückenakt mit seinen ausgeprägten Trapez- und Deltamuskeln zeigt, dass das Naturstudium trotz aller Betrachtung antiker Vorbilder unerlässlich für das Verständnis der menschlichen Anatomie war. Die Hand des Künstlers überführte die Naturschönheit des Modells schließlich in die vollkommene und überindividuelle Kunstschönheit des Klassizismus.
Vorbild mit revolutionärem Keim
Das moralische Lehrgebäude, das der Kunst des Klassizismus innewohnt, veranlasste Kritiker zu Bemerkungen wie „Gedankenkunst“ oder „Kühlschrankerotik“, an der das Sinnliche zu erfrieren drohe. Tatsächlich beschreibt die „genuin“ klassizistische Kunst keine natürliche Schönheit, sondern eine vollkommene, makellose, überzeitliche, idealische und eben dadurch unerreichbare Schönheit. Sie ist ein Vorbild mit normativem Charakter. Wenn man so will, ist es bei ihr wie mit den Zehn Geboten: Jeder Christ ist bestrebt, sein Leben danach auszurichten, aber er vermag sie nicht durchweg einzuhalten. Die revolutionäre Kraft des Klassizismus entlädt sich im nächsten Blogbeitrag...
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.