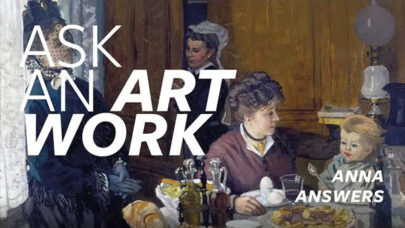Camille. Camille.
Sie begegnet den Besuchern der Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ im Städel Museum immer wieder aufs Neue: Sitzend, stehend, liegend, im Profil, in der Rückenansicht und – man ahnt es schon – auch frontal dargestellt. Sie ist Camille. Modell, Geliebte und spätere Ehefrau von Claude Monet. Wie geht Monet mit diesem besonderen Motiv um?

Claude Monet (1840-1926); Camille auf dem Totenbett, 1879; Öl auf Leinwand, 90 x 68 cm, Museé d’Orsay, Paris, Schenkung Katia Granoff, 1963; Foto: Städel Museum
Ihr Gesicht ist zu einer Maske erstarrt. Graublaue Pinselstriche, rhythmisch gestrichelt und mit rosa und violetten Akzenten gemischt, bilden ein Netz, in dem die zentrale Figur zu verschwinden droht. Das Gemälde „Camille auf dem Totenbett“ aus dem Jahr 1879 ist wohl das radikalste, das Claude Monet (1840–1926) gemalt hat. Es zeigt seine erste Ehefrau Camille (1847–1879) nach ihrem frühen Tod im Alter von nur 32 Jahren. Camille-Léonie Doncieux lernte Monet 1865 mit achtzehn Jahren in Paris kennen, nachdem sie mit ihren Eltern aus Lyon dorthin gezogen war. Sie stand ihm Modell und wurde schnell seine Geliebte, doch erst 1870 heirateten die beiden. Nach ihrem Tod schrieb Monet: „Ich stand einmal am Bett einer Toten, die mir sehr teuer gewesen war und immer sein wird. Plötzlich ertappte ich mich, wie ich, die Augen auf die tragische Schläfe geheftet, dabei war, mechanisch den Abschattierungen des Kolorits zu folgen, das der Tod auf das unbewegliche Antlitz gelegt hatte. Blaue, gelbe, graue Töne – was weiß ich. Soweit war es mit mir gekommen.“ Das Antlitz der soeben verstorbenen, geliebten Frau diffundierte vor den Augen des Malers im effektvollen Farbspiel. Die Auflösung des Motivs im Bild spiegelt das Verschwinden Camilles aus dem Leben des Künstlers wider.
Das Leuchten der Camille
Monet klagte sein Leid des automatisierten, impressionistischen Sehens einem Freund, dem Politiker und späteren Premierminister Georges Clemenceau (1841–1929). Damit antwortete er auf Clemenceaus Analyse ihrer unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen: „Wenn ich einen Baum anschaue, sehe ich nichts als einen Baum. Sie dagegen haben die Augen halb geschlossen und denken: aus wievielen Tönen wievieler Farben [sic!] in leuchtenden Übergängen setzt sich dieser einfache Stamm zusammen?“ Zahlreiche Bilder in der aktuellen und am 28. Juni endenden Monet-Ausstellung im Städel Museum zeigen, dass der Künstler jene leuchtenden Farbübergänge häufig an Camille, seinem beliebtesten Modell, studierte. In „Das Mittagessen: dekorative Tafel“ von 1873 (aus der Sammlung des Musée d’Orsay) schlendert sie im Hintergrund durch den Garten, wohingegen sie in „Camille Monet mit Kind im Garten“ von 1875 (aus dem Museum of Fine Arts in Boston), im Vordergrund sitzt und in eine Textilarbeit vertieft ist. In dem Landschaftsgemälde „Sommer“ von 1874, eine Leihgabe der Berliner Nationalgalerie, sitzt sie, ihren Rock tellerrund ausgebreitet und den Sonnenschirm neben sich in das hohe Gras gesteckt, mit dem Rücken zum Betrachter im Schatten auf einer Wiese.

Claude Monet (1840-1926); Sommer, 1874; Öl auf Leinwand, 57 x 80 cm; Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie; Foto: bpk / Nationalgalerie, SMB / Jörg P. Anders
Nur Staffagefigur und schicker Lichtfänger?
Geduldig scheint sich Camille als lebende Leinwand hingegeben zu haben, auf der Monet Farb-, Licht- und Schattenspiele beobachten kann. Stets modisch gekleidet: Mit Sonnenschirm, eleganter Samtkappe mit Schleife oder Strohhut, im Seidenrock oder sommerlich-weißen Rüschenkleid präsentiert Camille die bürgerliche Damenmode im Paris des 19. Jahrhunderts. In der Rückenansicht in einer Landschaft stehend, fungiert sie als sorgsam komponierter Kunstgriff, um den Ausblick zu beleben und gleichzeitig eine sorglose, unbeschwerte Atmosphäre zu schaffen. In frühen Gemälden von Monet begegnet uns Camille sogar mehrfach in einem Bildaufbau. Ihre dunkeln Haare, die etwas steife Körperhaltung und ihr markantes Gesicht lassen sich leicht identifizieren – es sei denn, die Figur ist durch eine gesenkte Kopfhaltung wie bei „Sommer“ anonymisiert ist. Was folgt daraus? Ist Camille in Monets Bildern allein eine Staffagefigur, ein schicker Lichtfänger? Nur wenige Bilder lassen ein anderes Verhältnis von Maler und Modell erkennen.

Claude Monet (1840-1926); Das Mittagessen, 1868; Öl auf Leinwand, 231,5 x 151 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main, Public Domain; Foto: Städel Museum
Wo ihr Leben doch eine Rolle spielt
In „Das Mittagessen“ von 1868/69 aus dem Städel Museum ist Camille nicht einfach Modell oder Repräsentantin einer bürgerlichen Schicht. Vor dem Hintergrund ihrer Biografie erhält das Motiv des bürgerlichen Interieurs eine ansonsten verborgene Sinnebene und wird zur sozialen Studie: Denn Monet und Camille waren zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes nicht verheiratet und der kleine Junge, Jean, der fleißig seinen Löffel schwingt, ist ihr uneheliches Kind. Aufgrund seiner Liaison mit dem Modell und seines für damalige moralische Vorstellungen unerhörten Lebensstils hatte Monets Tante ihm sogar mehrfach die Unterstützung entzogen. Ab den frühen 1870er-Jahren wurde Camille zusehends schwächer und kränker. 1877 brachte sie ihr zweites Kind, Michel, zur Welt, wonach sich ihr Zustand weiter verschlechterte. Am Ende wird im bildlichen Festhalten des Verlusts der Geliebten, mit der eindringlichen Visualisierung des Verschwindens ihres Lebensgeistes, die persönliche Beziehung des Künstlers zu seiner Camille besonders stark. Schließlich wären ohne Camille zahlreiche der Bilder Claude Monets nicht denkbar.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.