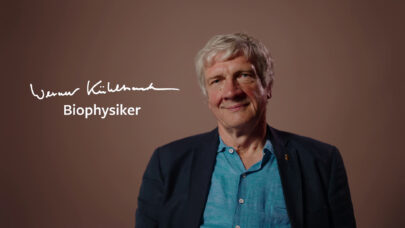Die Frauen im Blick – der Blick der Frauen
Frauen und Kunst – das ist ein großes Thema. Nur ein Schritt in die Bibliothek, ein Klick im Netz und schon findet man sich in einem Meer von Publikationen wieder. Weitaus leichter und lohnender ist der Weg in die Sammlungspräsentation der modernen und zeitgenössischen Kunst im Städel Museum. Wer hier nach den Frauen – in der Kunst und als Künstlerin – Ausschau hält, kann einiges entdecken.

In den Sammlungsräumen der Kunst der Moderne lassen sich viele Frauen als Bildmotiv finden. Max Klinger (1857–1920), Bildnis einer Römerin auf einem flachen Dach in Rom, 1891; Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main.
Ein Spaziergang durch die Sammlungsräume der Kunst der Moderne im Städel Museum hält bereits zahlreiche Begegnungen mit der Frau im Werk bereit. Allerdings treffen wir sie hier nicht als Künstlerin, sondern vorwiegend als Bildmotiv an. Ob als Tänzerin oder Badende, als Mädchen oder Dame, stets ist die Frau Objekt der Kontemplation, Inspiration oder Anregung des männlichen Künstlers. Die Frau hinter der Leinwand – die Künstlerin – ist hingegen weniger leicht aufzufinden. Viel Spürsinn ist dazu gefragt und vor allem eine gute Kenntnis weiblicher Vornamen. Denn spezifische Merkmale einer „weiblichen Kunst“ gibt es bislang keine.
Wer hält den Pinsel in der Hand?
Ottilie W. Roedersteins (1859–1937) „Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier“ von 1887 ist hierfür ein gutes Beispiel. Nichts in diesem unvollendeten und dennoch beeindruckenden Gemälde verweist auf das Geschlecht seines Urhebers. Da es jedoch eine Frau war, die dieses Bild malte, besitzt die Darstellung eine gewisse Brisanz: Nicht mehr der Mann, die Frau hält hier den Pinsel in der Hand. Und das Objekt der Kontemplation? Das ist der Mann, um genauer zu sein der Maler, den uns Roederstein, die bereits im Alter von 22 Jahren nach Paris übersiedelte und dort allein mit ihren Bildern ihren Lebensunterhalt bestritt, auf Augenhöhe präsentiert.

Ausgerechnet die Hand des jungen Malers, die einen Pinsel hätte halten können, wurde nie fertig gestellt. Ein Zufall? Ottilie W. Roedersteins (1859–1937), Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier, 1887; Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main.
Auch die Werke anderer Künstlerinnen, wie die von Käthe Kollwitz (1867–1945), Paula Modersohn-Becker (1876–1907), Ljubow Popova (1889–1924) oder Florence Henri (1893–1982) – deren Fotoarbeit „Pariser Fenster“ von 1929 erst kürzlich als Neuerwerbung ans Haus kam – stehen laut Felix Krämer, Sammlungsleiter der Kunst der Moderne im Städel, den Arbeiten ihrer Kollegen in nichts nach. Dennoch sind die männlichen Künstler in beinahe jeder Museumssammlung weiterhin in der Überzahl. „Die Gründe hierfür sind vielschichtig“ erklärt Krämer „die Benachteiligung der Frauen begann nicht im Kunsthandel oder im Museum, sondern schon bei der Ausbildung.“

Der gebrochene, reflektierte Blick ist charakteristisch für das Werk der Schülerin von Lázló Moholy-Nagy. Florence Henri (1893–1982); Pariser Fenster, 1929; Silbergelatine-Abzug (Abzug 1974); erworben 2013 als Schenkung von Annette und Rudolf Kicken. Städel Museum, Frankfurt am Main.
Von „Malweibern“ und „Damenakademien“
Tatsächlich blieben viele Kunstakademien bis in die 1920er Jahre den Frauen verschlossen. Als Rechtfertigung galt zum einen, dass ein gemischter Unterricht von Männern und Frauen nicht gestattet war. Auch war es Frauen in der Regel nicht erlaubt vor dem unbekleideten Aktmodel zu zeichnen. Hinzu kam die irrige Vorstellung, dass sich Frauen zwar für das Kunsthandwerk bzw. für das Kunstgewerbe eigneten, zu eigener schöpferischer Leistung jedoch nicht fähig seien. Diejenigen, die sich nichtsdestotrotz für eine Karriere als Künstlerin entschieden, wurden in Deutschland oft abfällig als „Malweiber“ bezeichnet. Sie erhielten ihre Ausbildung in der Regel an privaten „Damenakademien“.
Vor diesem Hintergrund erscheint es in der Tat revolutionär, dass Museumsstifter Johann Friedrich Städel (1728–1816) bereits 1815 in seinem Testament festhielt, dass die Schüler an seinem Institut „ohne Unterschied des Geschlechts und der Religion“ unentgeltlich unterrichtet werden sollten. Heute übersteigt die Anzahl der Studentinnen an den meisten Kunsthochschulen die der Studenten. Diese Entwicklung begrüßt Martin Engler, Leiter des Sammlungsbereiches Gegenwartskunst des Städel Museums: „Wir sind heute alle Zeugen einer spannenden Veränderung: Nie zuvor haben Frauen in der Kunstwelt so kräftig mitgewirkt – sei es als Professorinnen an Kunsthochschulen, als Galeristinnen, Kuratorinnen, Kunstkritikerinnen oder eben als Künstlerinnen.“ Dass sich dies noch deutlicher als bisher auf die Museen und ihre Sammlungen auswirken wird, davon ist Engler überzeugt.
Wandel in der Gegenwart
Mit dem Betreten der eigens für die Gegenwartskunst im Städel geschaffenen Gartenhallen fällt auf, dass sich in der Kunst nach 1945 schon ein entscheidender Wandel vollzogen hat: Die Frau als Bildmotiv ist weitaus weniger dominant. Statt als Dargestellte tritt sie nun als Künstlerin hervor. Einen Vorgeschmack davon erhält der Besucher noch bevor er die Treppe zu den Gartenhallen hinabsteigt. Bereits am Eingang des Metzler-Foyers wird er zur linken Seite von Barbara Klemms (1939) Porträt „Andy Warhol“ (1981) und zur rechten Seite von Leni Hoffmanns (1962) eigens für das Städel entstandene Arbeit „sid“ (2010/2012) empfangen. Zum Zeitpunkt der Neueröffnung 2012 waren in demselben Raum zudem Katharina Sieverdings (*1944) Fotografie „Steigbild I“ von 1997 und Tamar Grcics Arbeit „Falten“ von 1997 zu sehen.

Leni Hoffmann (*1962), sid, 2010–2012, Mauerputz und Kipplack auf Wand. © VG Bild-Kunst Bonn, 2014.
In den Gartenhallen selbst begegnen wir schließlich zwei weiteren Künstlerinnen, deren Arbeiten maßgeblich dazu beigetragen haben, sowohl das Bild als auch die Stellung der Frau in der Kunstwelt zu überdenken: Rosemarie Trockel (1952) und Isa Genzken (1948). Während Trockel in ihrem maschinell gefertigten Strickbild „Who will be in in ’99?“ von 1988 nach dem weiteren Verlauf einer bislang männlich dominierten Kunstgeschichte fragt, lässt Genzken den Museumsbesucher durch ihr „Fenster“ von 1990 in den Ausstellungsraum blicken. Je nach Standpunkt des Betrachters, erscheint ein anderes Bild. Dies kann ein Gemälde an der gegenüberliegenden Wand sein oder ein Ausschnitt des Ausstellungsraumes. Beides erhält durch Genzkens Skulptur eine Rahmung, die gleichermaßen dazu einlädt, aus einer gewissen Distanz zu betrachten und zu fokussieren. Auf diese Weise wird das Sehen bewusst und somit sichtbar gemacht. Da es sich hier insbesondere um das Sehen im Museum handelt, thematisiert die Arbeit darüber hinaus auch das Ausstellen und im weiteren Sinne die Kanonbildung der Kunstgeschichte: Was sehen wir und was nicht? Wer wird uns gezeigt und wer nicht?
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.