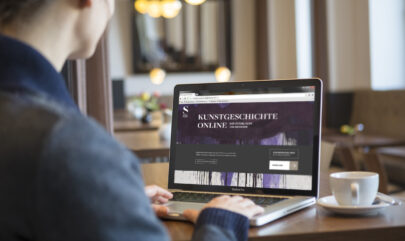Wilhelm Freddies „Pro Patria“
Wilhelm Freddie gilt als Dänemarks Aushängeschild für surrealistische Kunst. Sein Gemälde „Pro Patria“ ist ein visuelles Verwirrspiel – und eine Reaktion auf politisch turbulente Zeiten.
Die surrealistische Revolution
Es gibt Bücher, die ein Leben verändern können. In Wilhelm Freddies (1909–1995) Fall war es kein Buch, sondern die Zeitschrift La Révolution surréaliste, das Sprachrohr der internationalen surrealistischen Bewegung. Dessen Herausgeber André Breton sollte bald zu einem wichtigen Verbündeten Freddies werden – und der junge Einzelgänger und Autodidakt zum wichtigsten Surrealisten Dänemarks.
Als dem damals zwanzigjährigen Freddie die zwölfte und letzte Ausgabe der Zeitschrift in die Hände fiel, war er jedenfalls geläutert. Seine bis dahin praktizierte abstrakte und kubistische Malweise legte er ab und folgte ab sofort dem surrealistischen Prinzip, das „hinter den Dingen“ Befindliche hervorzubringen: Träume, das Unbewusste und Visionäre. So wie es Breton bereits 1924 in seinem ersten surrealistischen Manifest festgehalten hatte: „Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität“.

Wilhelm Freddie, Pro Patria (1941), Öl auf Leinwand, 100,4 x 77,0 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Nichts ist, wie es scheint
Logik und Verstand hebt Freddie auch in dem Gemälde Pro Patria (1941) auf, das seit Kurzem zur Sammlung des Städel Museums gehört. Der Künstler kombiniert Personen und Objekte inmitten einer kargen Landschaft und entzieht sie der uns bekannten Bedeutung. Der lachende, Richtung Bildrand laufende Junge trägt anstelle eines Huts: einen Mann auf dem Kopf. Die elegant gekleidete – jedoch armlose – Dame im Hintergrund erinnert an eine Säule, ein Eindruck, der durch den architektonischen Sockel verstärkt wird. Die Mauer, an der sie mit geschlossenen Augen lehnt, weist eine organische Oberfläche wie die eines Baumes auf. Der Körper, der über dem Mauerdurchbruch kniet, wirkt unheimlich leblos und lässt uns an Hinrichtungen denken.

Detail aus: Wilhelm Freddie, Pro Patria (1941), Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Ergänzt wird das Ensemble durch morbide Details wie den leicht geöffnete Sarg in der unteren rechten Bildecke oder den Kadaver eines Greifvogels oben links. Krönender Abschluss des Verwirrspiels sind zwei Bilder am Rande des Mauerdurchbruchs und ein Auge, das uns von der angeschnittenen Fassade im Bildhintergrund anstarrt.
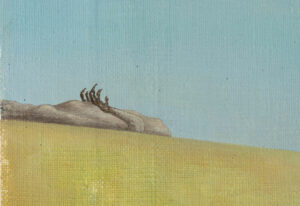
Detail aus: Wilhelm Freddie, Pro Patria (1941), Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Ein Anker bleibt: Einzig die Danneborg, die dänische Nationalflagge in der Hand des Jungen, scheint ihrer Sinnhaftigkeit nicht verfremdet zu sein. Sie, der Gemäldetitel und das Entstehungsjahr des Werks lenken unsere Aufmerksamkeit in eine dunkle Zeit der Geschichte Dänemarks – die deutsche Besatzung von 1940 bis 1945.
Für das Vaterland
Wilhelm Freddie sprach sich vehement gegen den deutschen Nationalsozialismus aus und kritisierte Adolf Hitler offenherzig, mitunter in seiner Malerei. Seine Äußerungen führten 1938 zum Einreiseverbot für Deutschland. An seiner politischen Orientierung hielt er selbst während der Besatzungsjahre fest, als die Nationalsozialisten surrealistische Werke zensierten. 1944 flüchtete Freddie schließlich ins benachbarte Schweden, wo er bis 1950 blieb. Pro Patria, lateinisch „Für das Vaterland“, markiert somit entscheidende biografische und historische Momente. Es vereint charakteristische visuelle Konzepte des Surrealismus mit Wilhelm Freddies persönlicher politischer Einstellung.
Enfant terrible
Die öffentliche Anerkennung Freddies blieb lange aus. Zwar hatte er 1935 auf die Einladung André Bretons hin an der ersten surrealistischen Schau des Nordens, der Kubisme – Surrealisme in Kopenhagen, teilgenommen und wurde in internationalen Künstlerkreisen geschätzt, allerdings polarisierten seine Werke auch. Vielen galten sie als Pornografie. Immer wieder hingen Besucher seine Gemälde in Ausstellungen ab, beschlagnahmten Zoll und Polizei seine Werke und verurteilten ihn zu Haftstrafen. Die konfiszierten Gemälde wurden der Öffentlichkeit im Kriminalmuseum als Anschauungsmaterial präsentiert. Erst nach mehrjährigen Prozessen gelang es dem Künstler in den Sechzigerjahren, seine Bilder zurückzuerwerben.
So verbrachte Freddie die erste Hälfte seines Künstlerdaseins verarmt und von der breiten Öffentlichkeit unverstanden. Erst nach seiner Rückkehr aus Schweden 1950 rehabilitierte ihn eine große Einzelausstellung in Kopenhagen. Heute sind die Dänen stolz auf ihren großen Surrealisten.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.