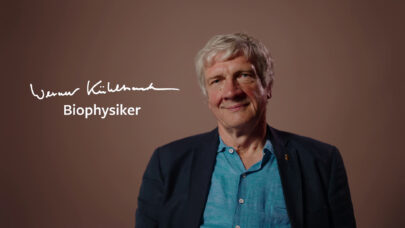Alle Wege führten nach Rom
Um 1800 strömten Künstler aus ganz Europa nach Rom. Ihr Ziel war, die antiken Kunstwerke im Original zu studieren, sie fanden dort aber auch noch andere Vorteile: Freiraum, Gleichgesinnte und rauschende Feste. Die Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ zeigt Kunstwerke, die in dieser römischen Aufbruchs-Atmosphäre geschaffen wurden.

Johan Tobias Sergel (1740–1814); Faun, 1774; Marmor, 47 x 86 cm; Sinebrychoff Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki
Wein, Weib und Kunst – Bacchanalien bei Sergel
Der schwedische Bildhauer Johan Tobias Sergel (1740–1811) konnte 1761 durch ein Stipendium seiner Stockholmer Akademie erstmals nach Rom reisen. Einer seiner frühesten römischen Skulpturen ist der Faun, der auch in der Schau im Städel zu sehen ist: Dieser in Marmor gehauene, sich lasziv räkelnde Faun spiegelt das leidenschaftliche Leben, welches Sergel und seine Künstlerfreunde in Rom suchten, wider. So veranstaltete der Genussmensch Sergel in der Villa Madama legendär gewordene sogenannte Bacchanalien. Zu diesem ursprünglich antiken römischen Fest zur Feier des Wein-Gotts – Bacchus – lud Sergel einen geschlossenen Künstlerkreis ein.

Jacques-Louis David (1748–1825); Belisar; 1784; Öl auf Leinwand, 131 x 145,5 cm; Musée du Louvre – Département des Peintures, Paris
Rom für fünf Jahre – Künstlerstipendien
Seit 1666 verlieh die Pariser Académie royale de peinture et sculpture einen Preis an Künstler, mit dem ein mehrjähriger Aufenthalt in Rom an der dortigen Académie de France verbunden war. 1774 erhielt der Maler Jacques-Louis David (1758–1825) den Preis und somit die Möglichkeit für einen fünfjährigen Romaufenthalt. Dies sollte einen gravierenden Einschnitt in seinem Schaffen bilden. Der Künstler bezeichnete das Studium der Antiken in Rom später als eine Augenoperation. Zurück in Paris schuf er 1748 unter dem Einfluss seiner römischen Eindrücke das Gemälde Belisar, das als Davids erstes klassizistisches Gemälde gilt. Auch dieses Werk findet sich in der Ausstellung in Frankfurt.

John Flaxman (1755–1826); Die Prozession der trojanischen Frauen, 1793; Feder, 232 × 331 mm; Royal Academy of Arts, London
Ateliergemeinschaften – Canova und Flaxman
1779 traf der venezianische Bildhauer Antonio Canova (1757–1822) erstmals in Rom ein – und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1822. In Rom schuf er 1783 unter anderem auch das Werk, das als erste moderne Skulptur der 1780er Jahre angesehen wird: Theseus und Minotauros. 1790 bis 1792 arbeitete der englische Bildhauer John Flaxman gemeinsam mit Canova im selben Atelier. Im Motiv der trauenden trojanischen Frauen maßen die beiden Künstler ihr Können. Die Ergebnisse können in der Ausstellung sowohl in einer Zeichnung Flaxmans als auch in einem Relief Canovas mit demselben Motiv betrachtet werden.

Joseph Anton Koch (1768–1839), nach Asmus Jakob Carstens; Die Argonauten, Besuch bei Chiron (1799); Radierung, ca. 214 x 250 mm; Universität Innsbruck, Institut für Kunstgeschichte, Innsbruck
Alte Zöpfe abschneiden – Freiraum in Rom
Nicht alle Künstler gelangten dank der Unterstützung ihrer Heimatakademie nach Rom. Im Gegenteil: Der österreichische Maler Joseph Anton Koch (1768–1839) war aus Stuttgart geflohen und hatte sich den an der dortigen Akademie vorgeschriebenen Zopf abgeschnitten. Gemeinsam mit seinen Künstlerfreunden, zu denen auch der in der Ausstellung vertretende Maler Asmus Jakob Carstens ( 1754–1798) gehörte, träumte er von einer „römischen Künstlerrepublik“. Carstens hatte sich ebenfalls von seiner heimischen Berliner Akademie in einem Absage-Brief losgesagt: „Uebrigens muß ich Euer Excezellenz sagen, daß ich nicht der Berliner Akademie, sondern der Menschheit angehöre.“ In der Ausstellung widmet sich ein ganzer Raum Carstens und seinen nordischen Kollegen, insbesondere dem dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770–1844).

Bertel Thorvaldsen (1770–1844; Ganymed, eigenhändiges Marmorexemplar, 1819–1821, nach dem originalen Gipsmodell aus dem Jahr 1816; Marmor, H. 135,7 cm; Thorvaldsens Museum, Kopenhagen, Foto: Thorvaldsens Museum
Wie neu geboren! Die Ankunft in Rom – Einflüsse und Freundschaften
Den Tag seiner Ankunft in Rom feierte der dänische Bildhauer Thorvaldsen als seinen zweiten Geburtstag. Neben den Originalen der Antike studierte er dort aber auch Zeichnungen seines zeitgenössischen Kollegen Carstens. Viele Künstler wohnten oft im selben Viertel oder sogar gemeinsam in einer Wohnung, so wie Thorvaldsen und sein Maler-Kollege Joseph Anton Koch. Abgesehen von der Académie de France hatten die meisten ausländischen Künstler in Rom keine institutionelle Anlaufstelle. Sie vereinigte jedoch ein neues Phänomen: der Freundschaftskult zwischen Künstlern und Intellektuellen – sie fühlten sich durch gemeinsame Ideen über Kunst und Ansichten zur Gesellschaft miteinander verbunden.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.