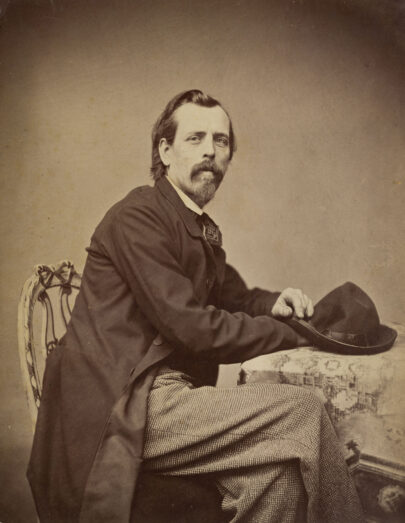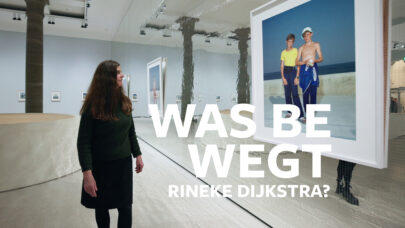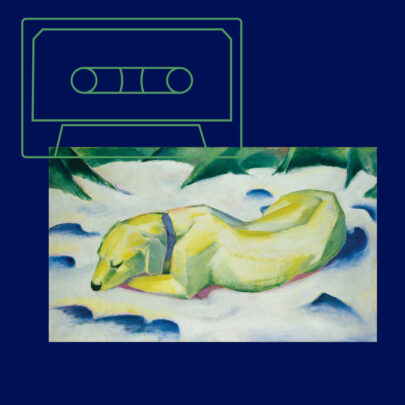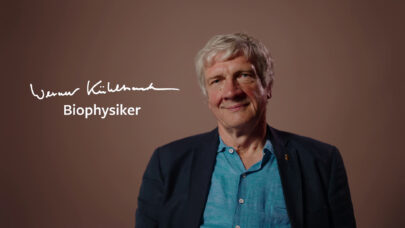Rineke Dijkstra und die 1990er-Jahre
Inmitten der globalen Umbrüche der 1990er-Jahre schuf Rineke Dijkstra ihre „Beach Portraits“. Die zeitlosen Porträts junger Menschen wurden an Stränden rund um den Globus aufgenommen – an Orten, die ebenso wie ihre Protagonisten von politischen und kulturellen Umbrüchen geprägt waren. Ein Blick auf die Umstände ihrer Entstehung.
Politischer Hintergrund
Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 in Ost-Berlin begann der Zerfall der Sowjetunion, am 31. Dezember 1991 wurde ihre Auflösung offiziell besiegelt – die lange geltende Teilung in „Ost“ und „West“ schien überwunden. Die Euphorie über das Ende einer als unumstößlich empfundenen Weltordnung prägte vor allem die ersten Jahre. Es sollte jedoch noch einige Zeit vergehen, bis der Systemwechsel wirtschaftliche Verbesserungen brachte. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, zum Bespiel in Polen, war eine der Folgen. Vor allem in den kleineren Städten und Dörfern Polens war eine Verbesserung der Lebensverhältnisse kaum spürbar. Solche gesellschaftspolitischen Nuancen hallen in einigen Fotografien Dijkstras subtil nach und regen zur Auseinandersetzung mit der biografischen Situation der Porträtierten an.
Rineke Dijkstras Porträts zeugen von einer sensiblen Beobachtung des Menschlichen. Zwischen 1992 und 1998 bereiste die niederländische Fotografin verschiedene Küstenorte – von Long Island über Kolberg, Jalta, Odessa und Brighton bis nach Dubrovnik –, um Jugendliche in Momenten stiller Selbstinszenierung zu porträtieren. So zeigt eine Fotografie von 1993 einen Jungen aus Odessa, dessen Blick skeptisch und herausfordernd zugleich wirkt. Er posiert betont lässig; pinke Hose und locker gebundenes Hemd scheinen bewusst gewählt. Eine unbeschwerte Szenerie, die der grenzenlosen Offenheit und dem Optimismus der 1990er-Jahre auf den ersten Blick nicht widerspricht. Doch die ukrainische Hafenstadt steht exemplarisch für die komplexe Entwicklung postsowjetischer Länder: Die chaotischen Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion führten zu Armut und teilweise sozialer Verwahrlosung. Zeitweise lebten dort bis zu 5.000 Kinder auf der Straße.
In dieser Spannung zwischen scheinbarer Sorglosigkeit und prekären Lebensumständen liegt die Eindringlichkeit von Dijkstras Bildern: Sie verdichten die Frage nach der Zukunft einer noch jungen Generation. Auch in Dubrovnik, einem Schauplatz des Jugoslawienkrieges, porträtierte Dijkstra Jugendliche – zwischen Unschuld, Hoffnung und Unsicherheit.
Globale Beobachtungen
Die erste Station von Dijkstras internationalen Reisen waren die USA, wo ihr der Einfluss kapitalistischer Werbeästhetik auf das Selbstverständnis der Jugendlichen deutlich wurde. Schnell verstand sie, dass die jungen Menschen dort über ein stärkeres Gespür für Selbstinszenierung verfügten – geprägt durch die allgegenwärtige Bilderwelt der Medien. Unter diesen Eindrücken reiste Dijkstra nach Polen und 1993 in die Ukraine und beschäftigte sich mit der Frage der Selbstdarstellung jener jungen Heranwachsenden, die hinter dem Eisernen Vorhang eine gänzlich andere Sozialisierung erfahren hatten. In beiden Ländern traf sie auf Kinder und Jugendliche, die durch jahrzehntelange kommunistische Erziehung geprägt schienen. Besonders deutlich wird das in der Aufnahme vom Strand von Jalta: Drei Jugendliche stehen unbeholfen vor der Kamera, ihre Kleidung wirkt aus der Zeit gefallen, ihre Haltung ungekünstelt. Sie verkörpern ein anderes Lebensgefühl – eher zurückhaltend, unbeeinflusst vom westlichen Bildideal.
Wandel der Medien
Die 1990er-Jahre brachten neue Strömungen in der Popkultur und damit auch eine neue Rolle der jugendlichen Bildsprache: Grunge, Punk, Hip-Hop und Techno wurden zu Identitätsräumen jenseits der Ost-West-Grenzen. Auch in der Kunst rückte das Thema der Jugend in den Fokus. Künstler wie Nan Goldin, Marie-Jo Lafontaine oder Wolfgang Tillmans stellten mit ihren Werken Fragen nach Identität, Nähe und Zeit.
Seit den 1980er-Jahren, besonders in den 1990ern, erlebte die Fotografie einen Boom. Rückblickend zeigt sich ein inhaltlicher Wandel: Während die 1970er Jahre von inszenierten Bildwelten mit Kostümen und Requisiten geprägt waren, trat in den folgenden Jahrzehnten die nüchterne, dokumentarische Fotografie als Gegenbewegung in den Vordergrund. Mittlerweile ist das Bewusstsein für Manipulationsmöglichkeiten digitaler Bilder gewachsen, sodass die Frage nach der Authentizität von Fotografien einen neuen Stellenwert erhalten hat. Rineke Dijkstras Werke weisen durch ihre Wahl der fotografischen Technik eine besondere Wahrhaftigkeit auf: Seit jeher arbeitet sie mit einer analogen Großformatkamera, auch Plattenkamera genannt. Anfang der 1990er-Jahre – auch angesichts der wachsenden Präsenz von Kompaktkameras – ein seltener Anblick für die jungen Porträtierten, deren Eltern Dijkstra stets um Zustimmung zu den Aufnahmen bat.
Alltägliche Momente wie der Besuch am Strand finden sich verstärkt als Bildthema der 1990er-Jahre wieder: Vermeintlich allzu bekannte Alltagsszenen verweisen auf universelle Erfahrungen. Mit dokumentarischer Klarheit rufen Dijkstras Fotografien Erinnerungen beim Betrachter wach: an die eigene Jugend, an Erwartungen, an Träume. Selbst die Titel der einzelnen Beach Portraits halten sowohl Entstehungsort als auch den spezifischen Augenblick schriftlich fest.
Der Moment der Jugend
Dijkstras inzwischen historische Fotografien dokumentieren ein Jugendbild, das von der Unsicherheit, Neugier und dem Optimismus eines einzigartigen Moments der jüngeren Geschichte getragen wird. Einem Jahrzehnt, in dem sich neue Horizonte auftaten und doch nichts sicher war. Auch 30 Jahre später schwingt in den „Beach Portraits“ subtil und vielleicht eindringlicher denn je der Zusammenhang zwischen der universellen und essentiellen Frage nach der eigenen Identität in der Jugend und dem sich dahinter entfaltenden Kontext drastischer globaler Veränderungen mit. Sie sind Dokumente eines umbruchreichen Jahrzehnts und zugleich zeitlose Bilder des Erwachsenwerdens.
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.