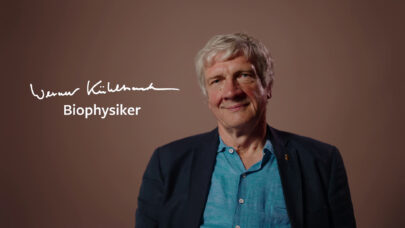Ewige Jugend: Ambrosia statt Botox
Sie stehen einander gegenüber und buhlen um die wohlgefälligen Blicke der Eintretenden. In der Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ empfangen uns zwei schwesterngleiche Skulpturen, die beide Hebe, in der griechischen Mythologie die Göttin der Jugend, darstellen. Der Italiener Antonio Canova und der Däne Bertel Thorvaldsen haben ihre unvergängliche Schönheit in Stein gehauen.

Mit der Schönheit Aug‘ in Aug‘: Die Heben von Antonio Canova und Bertel Thorvaldsen. Foto: Norbert Miguletz
Ihr familiärer Hintergrund liest sich wie eine Konstellation aus dem Reality-TV: Der Vater ein notorischer Fremdgeher, die Mutter eine eifersüchtige Ehefrau mit hinterlistigen Rachegelüsten. Kaum zu glauben, dass diese Ehe ein Geschöpf von solch zurückhaltendem Liebreiz hervorgebracht hat, wie Hebe es ist. Die Tochter des Götterpaars Zeus und Hera ist nicht nur Inbegriff jugendlicher Grazie – als Göttin der Jugend vermag sie diese auch an andere weiterzugeben. In der Ausstellung „Schönheit und Revolution“ schenkt Hebe gleich zweifach ihr verjüngendes Elixier aus.
Mundschenkin der Götter
Als Jugendgöttin in einer Schau, die sich der klassizistischen Schönheit widmet, ist der erste Saal der Ausstellung ihr prädestinierter Platz. Sie führt ein in einen Kosmos, der den unterschiedlichen Facetten des Stils Rechnung trägt – wie Hebe selbst demonstrieren wird. Unter den nach Maß und Harmonie strebenden Künstlern der Epoche war sie ein beliebtes Motiv, war Schönheit doch gleichzusetzen mit Jugend. Die beiden Versionen von Antonio Canova (1757–1822) und Bertel Thorvaldsen (1770–1844) geizen beide nicht mit ihren Reizen und enthüllen – wortwörtlich – die Ideale klassizistischer Schönheit.

Antonio Canova (1757–1822); Hebe, 1800–1805; Marmor, 158 cm; Staatliche Eremitage, St. Petersburg; Foto: Norbert Miguletz
Was auf Erden heute vermeintlich Hyaluron und Botox besorgen, waren auf dem Olymp Ambrosia und Nektar. Hebe war die Mundschenkin der Götter, deren Jugend sie mit ihrem Trank erneuerte und sie dadurch unsterblich machte. Auch Menschen konnte sie neue Jugend schenken. Ihr Elixier, worum wir Erdlinge uns raufen würden, wie die Römer sich um Miraculix‘ Zaubertrank, trägt Hebe in einem Kännchen mit sich. Obwohl sie seit ihrer Entstehung vielfach miteinander verglichen wurden, begegnen sich die marmornen Schönheiten von Canova und Thorvaldsen, die aus der Staatlichen Eremitage St. Petersburg und dem Thorvaldsens Museum aus Kopenhagen angereist sind, in der Ausstellung im Städel Museum zum ersten Mal. Diese Begegnung legt unübersehbar die Vorbildhaftigkeit von Canovas Hebe (1800-1805) für das zwischen 1815 und 1823 geschaffene Werk des jüngeren Kollegen Thorvaldsen offen, verdeutlicht aber zugleich die unterschiedliche Auffassung, die zwei Bildhauer im Klassizismus vom Idealschönen haben können.

Bertel Thorvaldsen (1770–1844); Hebe, 1815–1823; Marmor, 156,5 cm; Thorvaldsens Museum; Foto: Norbert Miguletz
Südliches Temperament und nordische Zurückhaltung
Die Leidenschaftlichkeit der reizbaren Hera hat Hebe nicht geerbt, wohl aber deren anmutige Gestalt. Wo sie nicht ohnehin entblößt ist, scheint ihre liebliche Figur durch das zarte Gewand hindurch. Canova zeigt seine Hebe barbusig und erst ab der Taille mit einem leichten Tuch umwickelt, das sich hinten in rauschende Falten legt. Die Mundschenkin des Italieners übt ihr Amt energischer aus, als die des Skandinaviers. Sie steigt, ihr goldenes Kännchen ostentativ emporhaltend, von einer Wolkenformation herab und scheint die Schale in ihrer Linken noch befüllen zu wollen. Im Unterschied zu Thorvaldsens Hebe haftet ihr etwas Momenthaftes an. Der Däne zeigt die Olympierin in sich gekehrt, den Blick auf die Schale mit dem kostbaren Inhalt gesenkt, und im Umgang mit ihren Reizen etwas schamhafter als ihr Gegenüber. Ihre Gestalt ist geschlossener und verharrt im stabilen Kontrapost, dem antiken Standmotiv. Die dänische zeitgenössische Schriftstellerin Friederike Brun (1765–1835) bringt es sinnfällig auf den Punkt: „Der Körper ist zart, rein, keusch, mehr Knospe als Blühte.“ Zu diesem Eindruck trägt auch das unvollendete Stadium der Oberfläche bei. Während Canova den Marmor polierte und die göttlichen Attribute vergoldete, ließ sein Kollege den Stein pudrig-ungeschliffen. Hat jene ihre Knospen schon entfaltet und ihr Potenzial voll ausgeschöpft, erblüht diese erst durch das Auge des Betrachters.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.