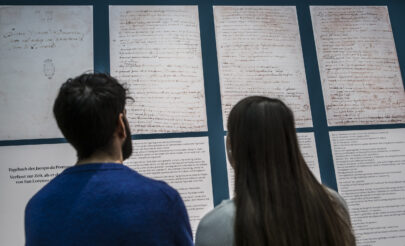Mehr als der Begründer der Kunstgeschichte
Kunstliebhaber denken bei Giorgio Vasari automatisch an seine „Viten“, der ersten historischen Darstellung italienischer Kunst. Doch auch seine Kunstwerke sollten genauer wahrgenommen werden, wie die Ausstellung „Maniera“ zeigt.

Vasari verfasste zusätzlich einen eigenen Begleitbrief für dieses Werk: Giorgio Vasari (1511–1574); Bildnis des Herzogs Alessandro de’ Medici, um 1534; Öl auf Pappelholz, 157 × 114 cm; Galleria degli Uffizi, Florenz; Foto: Su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Zu einem seiner in der aktuellen Ausstellung im Städel Museum gezeigten Werke gehört das „Bildnis des Herzogs Alessandro de‘ Medici“ (Galleria degli Uffizi, Florenz), welches 1534 als einer der ersten Aufträge für die Medici-Familie entstand und Giogio Vasaris (1511–1574) Ruhm als Maler und Schriftsteller gleichermaßen begründete – denn neben dem eigentlichen Gemälde verfasste Vasari zusätzlich einen eigenen Begleitbrief zum Werk. Das Bildnis zeigt den Herzog Alessandro de‘ Medici in glänzender Rüstung, während sein Blick auf der Stadt Florenz ruht. Gleichzeitig verweist die Sitzhaltung des Medici-Sprösslings auf das von Michelangelo geschaffene Grabmal des Giuliano de‘ Medici in der Neuen Sakristei in San Lorenzo. Von solchen berühmten Vorlagen hebt sich Vasari jedoch durch seine allegorische Überhöhung des Dargestellten ab, die er gleichsam in dem dazugehörigen Brief auflöst und zum Loblied für den Auftraggeber werden lässt. So verweise die Inszenierung mit der sprießenden Lorbeerpflanze auf die dynastische Kontinuität und das Wiedererstarken der Familie Medici. Das Rot des Umhangs des Herzogs stehe für das vergossene Blut der Feinde, die Figuren am Bein des Hockers verkörperten die unterjochten Feinde, der kreisrunde Sitz verweise auf die ewige Herrschaft des Herzogs und der brennende Helm auf den ewigen Frieden, den er gestiftet habe – wie uns der Maler in seinem Begleitbrief mitteilt. Diese Fähigkeit, die komplexe Botschaft des Herrscherporträts selbstständig literarisch zu erörtern, hat Vasari oft den Vorwurf der Selbstbeweihräucherung eingebracht. Sie ist jedoch auch Ausweis seiner Doppelbegabung als Maler und Schriftsteller zugleich.

Giorgio Vasari (1511–1574); Studie für Heilige Familie mit der heiligen Anna und dem Johannesknaben, um 1540–45; Feder in Braun, braun laviert, weiß gehöht, schwarze Kreide auf Papier, 24,7×17,9 cm; Albertina, Wien
Künstlerkollektiv und Produktionseffizienz – das Vierte Zeitalter der Kunstgeschichte nach Vasari
Zeichnungen, wie die „Studie für eine Heilige Familie mit der heiligen Anna und dem Johannesknaben“ (um 1540-45, Albertina, Wien), machen hingegen deutlich, dass Vasari über Jahre hinweg nicht nur seine Bilddarstellungen variierte, sondern auch, dass sich befreundete Maler ebenfalls auf seine Bilderfindungen bezogen. So schuf Vasari unterschiedliche Versionen mit dem Motiv der Heiligen Familie, während der befreundete Maler Prospero Fontana mehrfach auf die Ideen Vasaris zurückgriff. Die in der Ausstellung gezeigte Studie mit der Heiligen Familie ist somit – wie auch Jacopo Pontormos großformatige Darstellung von „Venus und Amor“ nach einem Karton von Michelangelo – Zeuge eines Austauschs zwischen den frühneuzeitlichen Künstlern, der schwer mit dem modernen Verständnis von Autorschaft als kreativer Akt einer Einzelperson zu verbinden ist. Gleichzeitig ist diese kollektive Autorschaft genau das, was Vasari auch in seinen Viten angesichts der Vervollkommnung der Kunst durch Michelangelo vorgeschlagen hat: In Anbetracht der bereits erreichten Perfektion bestehe der Sinn des gegenwärtigen künstlerischen Schaffens vor allem in der Steigerung von Effizienz und Schnelligkeit durch die Zusammenarbeit verschiedener Künstler.

Giorgio Vasari (1511–1574); Pietà Altoviti, 1542; Öl auf Holz, 192×136 cm; Mannedorf-Zürich, Collection Bruno Bischofberger, Schweiz
Neue „invenzioni“ – wie Giorgio Vasari mit der Ikonografie experimentiert
Aber nicht nur in den Bereichen der kollektiven Autorschaft oder der allegorischen Ausstattung von Herrscherporträts hat sich Giorgio Vasari auf neue Wege begeben: Auch die Ikonografie einiger Darstellungen, die im frühen 16. Jahrhundert noch nicht so gefestigt war wie heute oftmals angenommen, hat Vasari durch eigene „invenzioni“ revolutioniert und geprägt. Dazu gehört die ebenfalls in der Ausstellung zu sehende Pietà Altoviti (Collection Bruno Bischofsberger), die er 1542 für den Bankier und Mäzen Bindo Altoviti malte. Während die Darstellung von Mond und Sonne in der Ikonografie einer Kreuzigungsdarstellung zu dieser Zeit durchaus geläufig waren, so überraschen doch ihre Personifikationen als Sonnengott Phöbus und Mondgöttin Diana.

Von Vasari eingeführtes Bildthema: Giorgio Vasari (1511–1574); Die Toilette der Venus, um 1558; Öl auf Holz, 154 x 124,7 cm; Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart; Foto: Städel Museum
Auch bei der 1558 gemalten Darstellung der „Toilette der Venus“, die ihm über Jahre hinweg Anlass für mehrere Weiterentwicklungen des Bildsujets war, handelt es sich um ein von Vasari eingeführtes Bildthema, welches sich in den darauffolgenden Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreute. Bei der in der Städel Schau gezeigten Stuttgarter Version des Gemäldes handelt es sich um eine spätere Ausarbeitung des Motivs. Vor allem die feine Abstufung der Hautfarben, die präzise Darstellung von Stofflichkeit und die Weiterentwicklung des Bildthemas machen es zu einem der qualitätsvollsten Werke Vasaris. Gleichzeitig wird die Schönheit der Venus, die der neuplatonische Philosoph Marsilio Ficino mit dem Begriff „grazia“ verband, zu einem der zentralen Begriffe der „maniera“. Denn „grazia“ im Sinne von Anmut galt Vasari als fundamentales Kriterium für die Qualität eines Kunstwerks und gleichzeitig als grundlegendes Merkmal der „maniera moderna“, deren Begriff er in seinen auch heute noch so bekannten Viten prägte.
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.