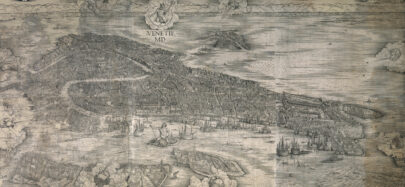Das Geheimnis der Frau in Blau
Noch rätselhafter als ihr Blick war bisher das Gefäß, das die „Dame in Blau“ in der Hand hält. Kurator Bastian Eclercy hat endlich ihr Geheimnis gelüftet.
Aus dem schwarzen Nichts tritt sie uns entgegen und droht doch gleich wieder dorthin zu verschwinden. Woher sie wohl kommt? Aus der National Gallery of Art in Washington ist diese Dame in Blau nach Frankfurt gereist, so viel ist klar. Prominent hängt sie nun in einer zentralen Achse der Ausstellung Tizian und die Renaissance in Venedig und zieht die Besucherinnen und Besucher von weitem in ihren Bann: das bestechende Blau, dieser Blick – und dann das merkwürdige Gefäß. Was führt die Frau im Schilde? Auch Kunsthistoriker hat diese Frage lange herumgetrieben. Ich denke, wir können sie nun beantworten.

Sebastiano del Piombo, Dame in Blau mit Parfümbrenner, um 1510/11, Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection
Der Maler: Sebastiano del Piombo
Das Bild stammt von einem der großen Talente unter den Malern Venedigs im frühen 16. Jahrhundert: Sebastiano del Piombo, der um 1510/11, als das Bild entstand, seinem wenige Jahre jüngeren Zeitgenossen Tizian sogar einen Schritt voraus war. Giorgione war zu dieser Zeit bereits verstorben, Giovanni Bellini ein alter Mann, die jüngeren Vertreter der venezianischen Renaissance, Jacopo Tintoretto und Paolo Veronese, noch gar nicht geboren. Welchen Weg hätte die Malerei in Venedig wohl genommen, wäre Sebastiano in seiner Heimatstadt geblieben, und wäre nicht gerade da der junge Tizian als rising star am Malerhimmel der Lagunenstadt erschienen? Wer weiß…
Die Dame in Blau dürfte in Sebastianos letzten Monaten in Venedig entstanden sein, kurz bevor er im Sommer 1511 seinem Mäzen, dem sienesischen Bankier Agostino Chigi, nach Rom folgte. Die junge Dame entspricht ganz Sebastianos Frauentypus in jener Zeit: ein fleischig-rundliches Gesicht, volle Lippen, geheimnisvoller Blick, markante Brauen und dunkelblondes, in der Mitte gescheiteltes Haar. Seiner Salome (oder Judith?) von 1510 ist die Dame in Blau schwesterlich verwandt; beide tragen sogar das gleiche Kleid: ein hochgekrempeltes weißes Untergewand, darüber glänzt die blaue Seide.

Sebastiano del Piombo, Salome (oder Judith?), 1510, London, National Gallery
Das Bild: Verlockung in Blau
Das Blau vermag jedoch nicht von ihrem Blick abzulenken, der von solch rätselhafter Unbestimmtheit ist, dass er einen kaum loslässt: eindringlich und versonnen, kritisch musternd und lockend zugleich. Wie Elfenbein leuchtet die makellose Haut, wie Gold das dunkelblonde Haar.
Ihr Unterarm lenkt den Blick auf die Gerätschaft, die sie mit grazilem Gestus in der Rechten hält – neben ihrem Gesicht das zweite, nicht weniger enigmatische Zentrum des Bildes. Doch was ist das eigentlich? Von der Beantwortung dieser entscheidenden Frage hängt die Identifizierung der geheimnisvollen Dame ab.

Sebastiano del Piombo, Dame in Blau mit Parfümbrenner (Detail), um 1510/11, Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection
Die Dargestellte: eine kluge Jungfrau?
An diesem Problem hat sich die Kunstgeschichte schon seit längerem abgearbeitet. Eine Bestimmung des Gerätes als Salbgefäß führte zunächst zu einer Deutung der Figur als Heilige Maria Magdalena, bis man den Gegenstand schließlich als Lampe identifizierte. Damit galt die Dame seither als eine der fünf Klugen Jungfrauen aus dem Matthäus-Evangelium (25,1-13).
Das biblische Gleichnis ist bekannt und oft dargestellt worden: Zehn Jungfrauen gehen einem Bräutigam mit ihren Lampen entgegen. Die fünf törichten unter ihnen vergessen jedoch, das Öl für die Lampen mitzunehmen. Die Gunst des Bräutigams gilt dann natürlich den fünf klugen Jungfrauen, die in weiser Voraussicht Öl in Krügen mit sich führen und ihre Lampen damit zum Einsatz bringen können.
Doch seltsam: Was macht denn eine Kluge Jungfrau ohne ihre vier Gefährtinnen? Bei der Erforschung des Bildes im Vorfeld der Ausstellung trieb mich diese Frage um. Die genaue Betrachtung des Attributs führte zu einer Entdeckung.

Sebastiano del Piombo, Dame in Blau mit Parfümbrenner (Detail), um 1510/11, Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection
Ein Detail: der Schlüssel zur Deutung
Auf einem plastisch gearbeiteten Fuß aus Rotmarmor steht ein Metallgefäß, das aus Messing gefertigt sein dürfte. Es ist oben geschlossen und überall mit kleinen Löchern versehen. Aus zweien dieser Löcher steigen kleine Funken und dünne Rauchfäden auf: Das Gerät kann also aufgrund seiner materiellen Beschaffenheit kein Licht spenden. Es handelt sich eindeutig nicht um eine Lampe, sondern um ein Räuchergefäß, in dem wohlriechende Essenzen verbrannt werden. Der duftende Rauch entweicht aus den Löchern. Solche Brenner für aromatische Stoffe sind kultischen Ursprungs, wurden aber wie Parfüm eingesetzt. Daher rührt sogar die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Parfüm (von lateinisch per fumum, durch Rauch).
Eine bislang unbeachtete Parallele findet sich in einem berühmten Werk der venezianischen Malerei: Lorenzo Lottos Venus und Amor in New York zeigt in sinnesfreudiger Erotik den Amorknaben durch einen von Venus gehaltenen Myrtenkranz urinierend. Daran wiederum ist ein goldfarbenes Metallgefäß befestigt, aus dem Rauchfäden aufsteigen. Ganz offenkundig haben wir es hier mit demselben Typ von Gerät zu tun.

Lorenzo Lotto, Venus und Amor, um 1520-30, New York, Metropolitan Museum of Art
Die Dame mit Parfümbrenner: eine „Bella Donna“
Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für das Verständnis unseres Bildes. Wir haben es demnach definitiv nicht mit einer sakralen Figur zu tun, weder mit einer Magdalena noch mit einer Klugen Jungfrau. Vielmehr entpuppt sich die Dame in Blau als eine bemerkenswert frühe Variante der venezianischen Bella Donna, die den Betrachter nicht nur mit dem Blau ihres Gewandes, sondern auch mit dem – gemalten – Duft ihres Parfümbrenners anzieht und betört. Jene Belle Donne („schöne Frauen“), denen die Ausstellung ein eigenes Kapitel widmet, sind ein typisches Genre der Renaissancemalerei in Venedig: rätselhafte, ambivalente, oft erotische Idealbilder weiblicher Schönheit; weniger reale Frauen als vielmehr fiktive Geschöpfe aus der Welt der Poesie.
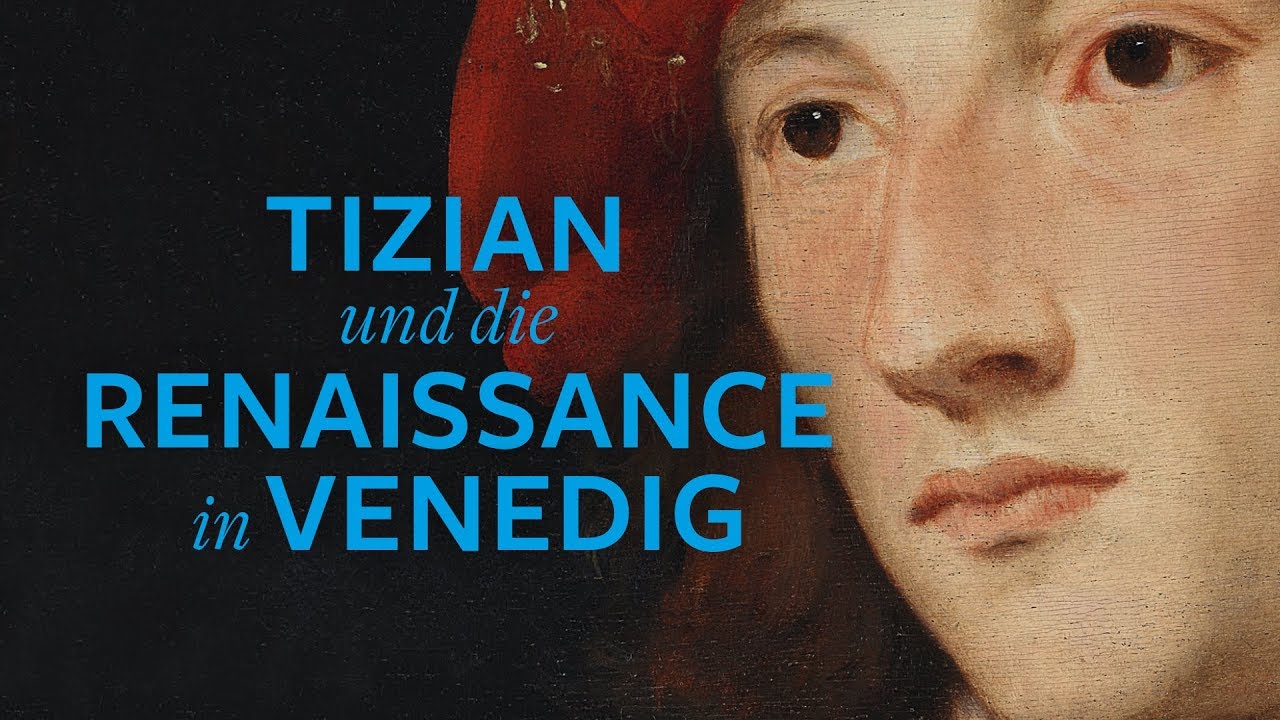
Mehr Stories
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.