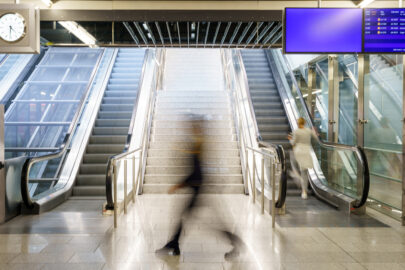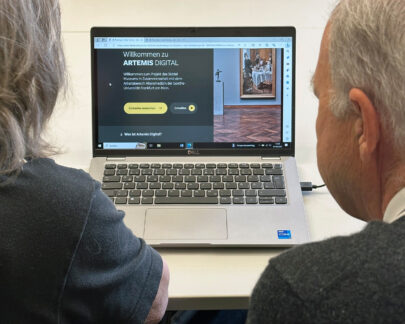Jüdisches Leben in der Moderne
1700 Jahre jüdisch-deutsche Geschichte – zum Festjahr stellen wir vier Werke aus unserer Sammlung vor, die ein Thema verbindet: Jüdisches Leben, Tradition und Religion im Städel Museum, in Frankfurt und darüber hinaus.
Moritz Daniel Oppenheim als Pionier seiner Zeit
Der in Hanau geborene Moritz Daniel Oppenheim (1800–1882) wuchs in der Judengasse, der heutigen Nordstraße, in einem jüdisch-orthodox geprägten Umfeld auf. Als erster jüdischer Künstler Deutschlands konnte Oppenheim aufgrund seines frühen künstlerischen Talents eine akademische Laufbahn einschlagen, was aufgrund seines Glaubens bis dahin undenkbar gewesen war. Denn obwohl sich bereits im beginnenden 19. Jahrhundert im Zuge der Emanzipationsprozesse ein jüdisches Bürgertum herausbildete, woran Oppenheim aktiv beteiligt war, erfolgte ihre Gleichstellung erst 1871, und die Frankfurter Jüdinnen und Juden wurden auch danach noch häufig von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert oder erfuhren Ablehnung. Ab 1825 wurde er in Frankfurt sesshaft und avancierte zum Porträtist des etablierten jüdischen Bürgertums, so zum Bespiel als persönlicher Maler der hoch angesehenen Frankfurter Bankiersfamilie Rothschild. Oppenheim schuf neben Porträts auch Historien- und Genrebilder, in denen er unter anderem Szenen aus dem Alten Testament und aus dem jüdischen Alltagsleben darstellte, womit er die jüdische Genremalerei als eine eigene Gattung in der europäischen Tafelmalerei begründete. Stolz nannte er sich daher selbst „Maler der Rothschild und Rothschild der Maler.“
Das Werk Die Verstoßung der Hagar (1826) im Städel Museum zeigt eine Szene aus dem Alten Testament (1. Moses 21, 9-21). Zu sehen ist, wie Abraham die Magd Hagar und den gemeinsamen Sohn Ismael fortschickt. Im Hintergrund ist seine Frau Sarah dargestellt, die Abraham aus Eifersucht und Sorge um ihren spät geborenen Sohn Isaak gebeten hatte, sich von Hagar und Ismael zu trennen.

Moritz Daniel Oppenheim, Verstoßung der Hagar, 1826, Städel Museum, Frankfurt am Main
Das Bild entstand während Oppenheims kurzer Verbindung zu den Nazarenern in Rom, einer Vereinigung um Johann Friedrich Overbeck (1789 – 1869), die die Malerei mithilfe des katholischen Glaubens zu erneuern versuchte. Oppenheim fand seinen eigenen Stil, indem er sich den Nazarenern malerisch annäherte, die beliebten alttestamentlichen Bildthemen aber etwas anders umsetzte: Gezielt ließ er Symbole weg, die zur üblichen Darstellungsweise gehörten, ihm aber „zu christlich“ erschienen. Dabei lenkte Oppenheim bewusst den Fokus auf eine Erzählung der jüdischen Überlieferung und integrierte diese in eine christlich geprägte Kunstgeschichte. Im Städel-Werk entschied Oppenheim sich dennoch für den Nimbus über Abrahams Kopf.
Taldmudische Gelehrsamkeit und Mystik bei Marc Chagall
Auch Marc Chagalls (1887–1985) Kunst ist durch seine jüdischen Wurzeln geprägt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert etablierte sich in Russland eine künstlerische Bewegung, die sich bewusst mit jüdischer Identität und Kultur auseinandersetze. Daran war auch Chagall aktiv beteiligt. Seine Kunst ist durch das russische Judentum, die talmudische Gelehrsamkeit und chassidische Mystik geprägt. Der Talmud, hebräisch für „Lehre“, erklärt die 613 Mitzwot, also Gebote und Verbote der Tora mithilfe von Geschichten, Gleichnissen und Kommentaren. Sie geben Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens und bilden den Rahmen für eine fromme Lebensform. Die jüdische Mystik, auch Kabbalah genannt, ist eine esoterische Subkultur innerhalb des rabbinischen Judentums. Im 18. Jahrhundert bildete sich in Osteuropa die religiös-mystische Strömung des Chassidismus als Teil des ultraorthodoxen Judentums heraus. Neben dem Studium der Kabbalah ist das gemeinsame religiöse Erlebnis, mitunter in Form von Tanz und Gesang, zentraler Bestandteil des Chassidismus.
Chagalls Kunst zeichnet sich durch einen ganz eigenen Malstil aus farbig expressiven bis weich abschattierten Pastelltönen und fantastisch-expressionistischen Traumwelten aus. Bevorzugt stellte Chagall Motive aus dem jüdischen Schtetl und dem Provinzleben seiner Heimat dar. Eng mit seinen Wurzeln verbunden, betonte Chagall 1936 , „(…) Ich habe, glaube ich, nicht nur einmal gesagt und sogar irgendwo geschrieben, dass ich, wenn ich nicht Jude wäre, auch kein Künstler wäre.“

Marc Chagall, Man sagt (On dit), Der Rabbi, 1912, Städel Museum, Frankfurt am Main
Das Porträt Man Sagt (On dit), Der Rabbiner (1912) zeigt einen Rabbi, der gerade dabei ist, sich eine Prise Schnupftabak zu gönnen. Er trägt einen schwarzen Mantel, darunter ein weißes Hemd, Kippa und Schläfenlocken (auch Pejes genannt). In seiner linken Hand hält er die Tabakdose und vor ihm liegt ein aufgeschlagenes Buch. Der Schnupftabak könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Rabbi gerade den Sabbat begeht. Denn das Entzünden von Feuer ist an diesem Ruhetag nicht erlaubt.
Sowohl die Signatur des Künstlers in der unteren rechten Bildecke als auch die Schrift auf einer der beiden Buchseiten steht auf dem Kopf. Auf Jiddisch steht hier unter anderem „Segal Mosche“, „Nur das haben“ und „Ich will“ geschrieben. Die restlichen Buchstaben sind willkürlich und unleserlich nebeneinander gesetzt. Auch im Davidstern rechts neben dem Rabbiner finden sich hebräische Buchstaben. Hier handelt es sich entweder um die Buchstaben Samech für „S“ und Tav für „T“, was abgekürzt „sefer tora“, also „Buch der Tora“ bedeutet. Demnach würde sich hinter dem Vorhang der Schrein befinden, in dem die Tora-Rollen aufbewahrt werden. Oder aber es sind die Buchstaben Mem sufit für „M“ und Tav dargestellt, was für das hebräische Wort „met“ spricht und übersetzt „tot“ bedeutet.
Die Geschichte, auf die Chagall sich hier vermutlich bezieht, stammt von Jizchok Leib Perez, einem bedeutenden jüdischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. In der Erzählung wird der Rabbi vom Satan in Versuchung geführt. Der tugendhafte Rabbi widersteht ihm, bis er von einem der Unterteufel hinters Licht geführt wird. Eine Prise Schnupftabak führt letztlich dazu, dass der Rabbi am Abend des Sabbat nicht rechtzeitig von seinem Spaziergang heimkehrt und damit die erste Sünde seines Lebens begeht. Denn am Sabbat sollen für gewöhnlich alle Tätigkeit ruhen.
Max Beckmanns Blick auf das ‚jüdische Frankfurt‘ der Vorkriegsjahre
Max Beckmanns (1884–1950) Werk Die Synagoge in Frankfurt am Main (1919) zeigt die Synagoge am ehemaligen Judenmarkt (16. Jh. bis 1885), dem heutigen Börneplatz. Die Frankfurter Israelitische Gemeinde war mehrheitlich liberal ausgerichtet, hatte aber auch eine Großzahl konservativer Mitglieder. Für letzt genannte wurde 1882 diese Synagoge erbaut.

Max Beckmann, Die Synagoge in Frankfurt am Main, 1919, Städel Museum, Frankfurt am Main
Im Bild öffnet sich der heutige Börneplatz in schiefen Winkeln: angeregt durch die ästhetische Formensprache des Kubismus führen Straßenzüge in zackiger Formierung aus dem Bild heraus und der damals sehr weitläufige Platz erscheint hier mitsamt den engen Häuserschluchten merkwürdig still. Drei kleine Figuren im Bild, dargestellt sind Beckmann rechts sowie seine Freunde Ugi und Fridel Battenberg werden förmlich von den schmalen Gassen verschluckt, während die speerartigen Laternenpfähle und überproportional große Katze am unteren Bildrand den Eindruck von Unordnung verstärken. Fast bedrohlich thront die zwiebelförmige grüne Kuppel auf dem Dach der Synagoge, dem größten Bau im Bild.
Fotografien der Synagoge zeigen, dass Beckmann sich diese ehemals prominente Ecke des Frankfurter Stadtbildes nach Belieben zusammenbaute. Das Gemälde entstand während Beckmanns Frankfurter Jahre (1915–1933). Heute existiert die Börneplatz-Synagoge nicht mehr, weil sie während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 bis auf die Außenmauern niederbrannte. Die Reste des Bauwerks musste die Gemeinde anschließend auf eigene Kosten abtragen.
Jakob Nussbaum und seine Heimat
Bedeutendster Frankfurter Maler des frühen 20. Jahrhunderts war Jakob Nussbaum (1873–1936), der 1883 mit seiner Familie aus Osthessen nach Frankfurt kam. 1922 gründete er unter anderem die Frankfurter Künstlerhilfe und unterstützte Künstler dabei, dass ihre Werke von der Städtischen Galerie am Städel Museum und bedeutenden Kunstsammlern der Stadt angekauft wurden.

Jakob Nussbaum, An der Hauptwache in Frankfurt am Main, Städel Museum, Frankfurt am Main
Das Werk An der Hauptwache in Frankfurt am Main (1901) war der Beginn einer Reihe von Stadtansichten, wobei er auch die Landschaft des Taunus’ und Odenwaldes liebte. In diesem Werk ist die eingeschneite Hauptwache an einem trüben Wintertag dargestellt. Der Blick fällt aus erhöhter Perspektive auf die Zeil Richtung Konstablerwache. Mit flüchtigem Pinselstrich deutet Nussbaum Passanten an. Im Vordergrund dominiert eine Straßenlaterne den Bildausschnitt.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flüchtete der bekennende Zionist im Oktober 1933 nach Kinneret am See Genezareth im heutigen Israel. Bei einer seiner Reisen viele Jahre zuvor entstand u.a. das Aquarell Abend am Kinereth-See (1925). Bei dem Abschied von seinem Freund Alfred Wolters, Direktor der am Städel angegliederten Städtischen Galerie, soll Nussbaum tieftraurig gesagt haben: „Wenn ich nur in Palästina auch ‘ne Odenwaldlandschaft malen könnte.“ Als Künstler hatte es Jakob Nussbaum schwer in seiner neuen Heimat. Neben Einkommensschwierigkeiten litt Nussbaum auch unter gesundheitlichen Problemen, denen er schließlich 1936 erlag.

Jakob Nussbaum, Abend am Kinereth-See, 1925, Städel Museum, Frankfurt am Main
Allesamt zeigen Oppenheim, Chagall, Beckmann und Nussbaum wie vielschichtig jüdisches Leben in der Moderne war, worin die Gemeinsamkeiten und Gegensätze lagen, und welchen Einfluss ihr Schaffen hatte. Anlässlich des Jubiläums 1700 Jahre jüdisch-deutsche Geschichte soll ihnen mit diesem Artikel ein Raum zur Erinnerung und Würdigung gegeben werden. Lotte Laserstein, Hanns Ludwig Katz, Rudolf Levy, Armin Stern, Fried Stern oder Rosy Lilienfeld: Auch sie stehen für das reiche, kulturelle Erbe jüdischer Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, das Teil der Städel Sammlung ist.
Newsletter
Wer ihn hat,
hat mehr vom Städel.
Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.